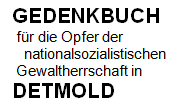„Anders als die Andern – Stigmatisiert. Verfolgt. Vergessen“
Jüdinnen und Juden aus Osteuropa
Rede zur Ausstellungseröffnung im Rathaus Detmold, 9. Oktober 2025
Gudrun Mitschke-Buchholz
Sie alle haben es in Erinnerung: In der letzten Zeit ihres unermüdlichen Wirkens schloss die Überlebende Margot Friedländer ihre Lebensberichte, ihre Zeitzeugenschaft stets mit einem Appell: „Seid Menschen!“ Sie beschwor die Zuhörenden mit der Dringlichkeit und der Erfahrung eines sehr langen Lebens als Jüdin von 103 Jahren. „Seid Menschen.“ Mit diesem so einfach und schlüssig klingenden Satz bezog sie sich nicht nur auf eine christlich-ethische Maxime, sondern auch auf einen unverrückbaren Wert der jüdischen Kultur und Tradition, nämlich die der Menschlichkeit. Sie setzte damit aber auch einen Ton und brachte die Welt des Jiddischen zum Klingen: „Er“ oder „sie is a mentsh.“ So heißt es dort. Und dies ist als Auszeichnung gemeint.
Mit diesem jiddischen Wort betreten wir auch die Welt der osteuropäischen Juden, die heute hier im Mittelpunkt stehen. Jüdinnen und Juden, die in Polen, in der heutigen Ukraine, in Galizien lebten und die vorrangig Jiddisch sprachen. Mit ihnen verbinden sich oftmals romantisierende Vorstellungen des Shtetls, jener untergegangenen, zerstörten Welt der Dörfer und Orte, in denen es eine große jüdische Gemeinde gab, die zusammen mit ihren nichtjüdischen Nachbarn lebte und für die ein Sprachengemisch von Polnisch, Ukrainisch, Deutsch und eben auch Jiddisch die Normalität ihres Alltags war. Viele der dort lebenden Jüdinnen und Juden waren fest verankert in ihrer Religion und in einem orthodoxen Ritus. Jüdische Schulen, jiddische Literatur und Theaterstücke, eigene jiddische Zeitungen – so vermittelt sich oftmals eine Seite dieses Kosmos. In populären Darstellungen wird durch die immerwährende Klarinette, durch Juden mit Schläfenlocken und im Kaftan, durch die Weisheiten des Rabbiners und durch eine ausgelassen tanzende Hochzeitsgesellschaft ein sehr prägendes Bild des Chassidismus nachhaltig gezeichnet. Die andere Seite dieser ostjüdischen Welt heißt bittere Armut und antijüdische, erbitterte Feindschaft, Überfälle auf jüdische Gemeinden, Gewalt und Hass und Angst vor Pogromen.
Viele Jüdinnen und Juden aus Osteuropa verließen aus diesen Gründen am Anfang des 20. Jahrhunderts ihre Heimat – in der Hoffnung auf den friedlicheren, reichen Westen, der ihnen eine bessere Zukunft zu versprechen schien. Berichte von verarmten, angefeindeten osteuropäischen Jüdinnen und Juden in den Metropolen wie Berlin, München und dem Ruhrgebiet sprechen allerdings eine andere Sprache. Auch nach Detmold kamen „die Ostjuden“ und ließen sich hier nieder. Die Ausstellung widmet sich der Familien Bonom-(Horowitz), Soltys-Gottlieb und Vogelhut, deren Lebensläufe ich hier natürlich nur in Stichworte umreißen kann.
Aus welcher Welt kamen sie? Und auf welche Welt trafen sie hier? Die Detmolder, die lippische Judenschaft verstand sich als eher liberal. Für viele spielte die Religion nur eine untergeordnete Rolle. Sie lebten in einer Welt des christlichen Kleinbürgertums, ländlich geprägt, in die sich die jüdischen Detmolderinnen und Detmolder einzufügen strebten. Eben nicht anders als die andern. Ihr Selbstverständnis wird durch den Begriff „des deutschen Staatsbürgers jüdischen Glaubens“ treffend umrissen. Die lippischen Juden, davon können wir ausgehen, hatten kaum oder gar keine Auslandserfahrungen. Polen, Russland oder Galizien waren weit weg. Ebenso das Jiddische. Ungeahnte, unbekannte Welten. Vor allem aber verkörperten – so meinten viele – „die Ostjuden“ das überwundene Stereotyp des orthodoxen Ghettojuden. Eine Welt, die die meisten Westjuden (wenn man so pointiert weiter sprechen will) hinter sich lassen wollten und die mit ihrer assimilierten, akkulturierten Welt nichts gemein hatte. „A clash of culture“ würden wir dies heute vielleicht nennen. Oder, um im Ton des heutigen Anlasses zu bleiben: „oj wej...“ Es war also ein schwieriges, komplexes Verhältnis, in dem so manche Ostjuden den Westjuden den Verlust der jüdischen Identität und Verrat am Jüdischsein entgegen hielten.
Die Familie Soltys-Gottlieb stammte aus Rozniatow in Galizien, das in seiner wechselvollen Geschichte bis 1918 zu Österreich und nach dem Ende des Ersten Weltkrieges zu Polen gehörte. In dem Ort in der heutigen Ukraine, unweit der östlichen Karpaten gab es bis zum Zweiten Weltkrieg eine bedeutende jüdische Gemeinde, die zu einer Bevölkerung von Polen und Ukrainern gehörte. Inwieweit das Zusammenleben wirklich so friedlich und einträchtig war, wie es oft beschrieben wird, bleibt fraglich. Unter Kaiser Franz Josef I. erlebten sie eine doch sehr vergängliche Blütezeit, in der Juden auf Augenhöhe mit den anderen Bürgern lebten, in der sie Richter, Lehrer, Professoren oder auch Offiziere sein konnten. Sie wählten sogar eigene Abgeordnete ins Wiener Parlament. Was für Zeiten – die sich auch in den Jahren „zwischen den Kriegen“ durch Bibliotheken mit jüdischer Literatur, Sportclubs Makkabi und jiddischen Theatergruppen repräsentierte. 1939 wohnten 1650 Juden in Rozniatow, das sind fast 42 % der Gesamtbevölkerung. Auch diese jüdische Gemeinde, dieses Shtetl, wurde in der Shoah vernichtet. Nach dem Einzug der Roten Armee kehrten 1944 noch zehn Juden nach Rozniatow zurück.
Die erhaltenen Dokumente wie die Einbürgerungsunterlagen zeugen davon, dass die Familie Soltys-Gottlieb 1908 nach Detmold gekommen war. Ihre jahrelangen, vergeblichen Bemühungen, hier eingebürgert zu werden, wurden erst 1923 mit der erhofften Urkunde allerdings zu einem nur vorläufigen Ende gebracht. Sie wurden als „lästige Ausländer“ diskreditiert – die „Ostausländer“ – deren Argument, sie würden ihre Kinder doch aber deutsch erziehen, nichts galt. Zwei Töchtern der Familie Soltys-Gottlieb und deren Mutter wurde die Staatsangehörigkeit 1934 umgehend wieder aberkannt. Die anderen Töchter wie Hedwig, verheiratete Gutwer oder Anna, verheiratete Vogelhut hatten durch die Heirat mit polnischen Männern automatisch die polnische Staatsangehörigkeit erhalten. Die Tochter Chana, die sich hier Anna oder Änne nannte, heiratete Josef Leib Vogelhut, der lieber Leo hieß. Josef, oder lieber Leo, kam aus Bochnia in Polen. Hier machten Juden vor dem Zweiten Weltkrieg 20% der Bevölkerung aus. Das dortige Salzbergwerk sicherte auch vielen Juden ein vergleichsweise gutes Auskommen und erlaubte in der Folge eine große Gemeinde mit entsprechenden Einrichtungen. Antisemitismus und letztlich die Angst vor Angriffen aus Nazi-Deutschland veranlasste auch die letzten dort Verbliebenen dazu, das Land zu verlassen. Im März 1942 wurde in Bochnia ein Ghetto errichtet, in dem 15.000 Menschen zu leben gezwungen waren. Etwa ein Jahr später, im Oktober 1943 wurde Bochnia als „judenrein“ erklärt.
Bereits viele Jahre zuvor, ebenfalls Anfang des 20. Jahrhunderts war die Familie Vogelhut aus Polen ausgewandert, zunächst nach Leipzig, dann nach Magdeburg, wo es der Vater der Familie mit Stolz schaffte, für sich und seine Familie ein eigenes Haus zu kaufen. Josef Leo Vogelhut wurde Kaufmann, zog nach Detmold und eröffnete 1931 mit seiner Frau Anna das „Detmolder Bekleidungshaus“, in dem Altwaren an- und verkauft wurden. Zu den ersten Geschäften am Platze gehörten sie damit sicher nicht. Als während des November-Pogroms die Fensterscheiben zerschlagen und die Geschäftsräume verwüstet wurden, lebte Anna Vogelhut bereits allein in Detmold, denn ihr Mann war am 28. Oktober 1938 aus Deutschland vertrieben worden. Dies geschah im Rahmen der sogenannten Polenaktion, bei der mehr als 17.000 jüdische Menschen polnischer Staatsangehörigkeit aus Deutschland ausgewiesen und gewaltsam an die polnische Grenze verschleppt wurden. Zuvor hatte nämlich die polnische Regierung ein Gesetz verabschiedet, das die Möglichkeit vorsah, polnischen Staatsangehörigen, die länger als fünf Jahre im Ausland lebten, die Staatsbürgerschaft zu entziehen, wenn sie nicht einen entsprechenden Prüfvermerk eines polnischen Konsulats vorweisen konnten. Die polnische Regierung fürchtete sozusagen den Rückstrom polnischer Juden. Dies war der mehr als willkommene Anlass für die deutschen Machthaber, die ersten Juden in großer Zahl loszuwerden. Dies ging blitzschnell und traf die polnischen Behörden zunächst unvorbereitet. Es entstand ein Auffanglager, Zbaszyn (deutsch: Bentschen), mit katastrophalen Bedingungen, in dem die Menschen zum Teil über Monate festsaßen, da die polnischen Behörden die Grenzen nach Polen inzwischen geschlossen hatten. Die Ausgewiesenen saßen buchstäblich im Niemandsland zwischen Deutschland und Polen – die einen vertrieben sie, die anderen ließen sie nicht ins Land. Diese unsägliche Situation erscheint mir als ein Sinnbild für die Lage der Jüdinnen und Juden: Nicht gewollt. Wurzellos.
Josef Leo Vogelhut wurde im Abschiebelager Zbaszyn interniert. Sein Antrag, nach Detmold wieder einreisen zu dürfen, um sein Geschäft zu liquidieren und die wirtschaftlichen Verhältnisse zu regeln, wurde vom Landespolizeiführer wenige Tage nach dem November-Pogrom abgelehnt. Aus seiner Sicht hatte sich mit den gewaltsamen Überfällen jener Nacht die Sache ohnehin erledigt. Anna Vogelhut sah sich nun gezwungen, das Geschäft zu liquidieren. Sie wurde in das „Judenhaus“ in der Gartenstraße 6 eingewiesen, bevor sie zu ihrer Schwiegermutter nach Magdeburg zog. Auch sie wurde letztlich gezwungen, Deutschland zu verlassen. Ihr letztes, verzweifeltes Lebenszeichen stammt aus Bochnia, aus dem Ort, den ihr Mann aus schlechten Gründen verlassen hatte. Über ihr weiteres Schicksal gibt es keine gesicherten Informationen. Vermutlich wurde sie ins Ghetto von Bochnia eingewiesen, das im September 1943 endgültig liquidiert wurde. Erschießungen und Deportationen nach Auschwitz löschten auch diese Gemeinde aus.
Etwas mehr ist über ihren Ehemann bekannt, dessen letzte Nachricht aus Tarnopol stammte. Wir wissen, aus Josef Leib, oder lieber Leo, Vogelhut war in Auschwitz die Nummer 25 544 geworden. Wann er dort ermordet wurde, ist nicht dokumentiert.
Aus Rozniatow stammte ebenfalls Rachel Bonom-Horowitz, geborene Glattstein-Fruchter, die sich hier nicht mehr Rachel, sondern Regina nannte. Seit 1904 lebte sie in Deutschland. Ihre Ehe mit Max Bonom, ebenfalls aus Galizien stammend, wurde 1921 geschieden. Mit ihm hatte sie drei Töchter. Eine Jüdin, noch dazu aus dem Osten, geschieden, alleinerziehend – ein schwieriger Status. 1921 eröffnete Regina Bonom in Detmold ein Alteisengeschäft, wurde dann Vertreterin für eine Firma in Bielefeld und eröffnete 1930 eine Pfandleihanstalt wiederum in Detmold. Nachdem Ende 1932 durch einen SS-Mann und Theologie-Studenten ihre Fensterscheiben eingeschlagen und die Waren gestohlen worden waren, um – wie er später zu Protokoll gab – „das Judentum zu schädigen“, wurde ihr Geschäft boykottiert. Regina Bonom-Horowitz wurde somit in die Verarmung und Fürsorge getrieben. Auch sie wurde bei der sogenannten Polenaktion ausgewiesen und in Zbaszyn interniert. Ihre Angelegenheiten zu ordnen wurde auch ihr untersagt. Ihr letztes Lebenszeichen vom Oktober 1941stammt aus dem Ghetto und Arbeitslager Rzeszow. Regina Bonom-Horowitz gilt offiziell als verschollen. Ihren drei Töchter gelang die Flucht nach Palästina. Ihr geschiedener Mann Max Bonom wurde aus Düsseldorf in das Ghetto Litzmannstadt (Lodz) verschleppt. Wo und wie er um sein Leben gebracht wurde, ist nicht bekannt. Auch er gilt als verschollen.
Kehren wir noch einmal zurück zur Familie Soltys-Gottlieb: Auch Anna Vogelhuts Schwester Hedwig, verheiratete Gutwer wurde in die Flucht getrieben. Zusammen mit ihrem Mann und ihrer Tochter Gerda floh sie nach Ausschreitungen in Bochum, wo sie lebten, nach Antwerpen. Nach dem Überfall durch deutsche Truppen wurden sie wiederum in die Flucht getrieben und gelangten schließlich in ein kleines Dorf, Vaudreuille, in der Haute Garonne, wo sie zumindest für eine kurze Zeit durch den dortigen Bürgermeisters Paul Juilla und seiner Familie ein Zuhause fanden. Nur für eine kurze Zeit, denn Emanuel Gutwer wurde interniert, Hedwig und Gerda wurden von einem Nachbarn verraten, daraufhin verhaftet und nach Drancy verschleppt, wo inzwischen auch ihr Ehemann und Vater eingewiesen worden war. Von dort wurden sie nach Auschwitz gebracht. Vermutlich wurden sie unmittelbar nach ihrer Ankunft ermordet.
Über die Familie Gutwer wissen wir vergleichsweise viel. Dies haben wir vor allem Thomas Algans aus Frankreich zu verdanken, der unermüdlich recherchiert und mich kontaktierte, als er meine Ausführungen im Gedenkbuch gelesen hatte. Er stellte mir dankenswerter Weise seine Forschungsergebnisse zur Verfügung. Doch warum recherchierte er so eingehend? Thomas Algans ist der Urenkel jenes Bürgermeisters Paul Juilla in dem Dorf Vaudreuille in der Haute Garonne, der viele Geflohene aufgenommen hatte und der sie nicht hatte retten können. Paul Juilla hatte aber der Familie Gutwer in der letzten Phase ihres Lebens noch einmal die kostbare Seite des Menschseins durch seine Freundschaft und seine Hilfe gezeigt. Und vielleicht hat jemand über ihn gesagt: „Er is a mentsh.“