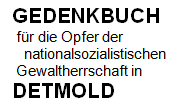Gudrun Mitschke-Buchholz
Gedenkbuch für die Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft in Detmold
Vorwort
Ein Gedenkbuch befindet sich durch beständige Forschung und durch die sich immer wieder erweiternde Quellenlage vor allem der letzten Jahre in einem steten Prozess der Veränderung und Vertiefung. Bereits bei der Drucklegung des Gedenkbuches für die Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft in Detmold (kurz: Detmolder Gedenkbuch) im Jahr 2001 wurden weitere Recherchen zur Ergänzung, Erweiterung und Verifizierung der hier dokumentierten Schicksale auf wissenschaftlicher und belegbarer Basis vorgenommen. So wurden die Arbeiten am Detmolder Gedenkbuch, das sich im Laufe der Zeit als fester Bestandteil der Erinnerungskultur vor Ort etabliert hat, stets fortgeschrieben, gegebenenfalls korrigiert und ergänzt.
2013 konnten die Namen von zwölf weiteren Opfern auf der Gedenktafel für die Opfer der NS-Gewaltherrschaft in Detmold dokumentiert und damit der öffentlichen Erinnerung zugänglich gemacht werden. Die eingehende Erforschung und Dokumentation auch dieser Lebenswege lässt sich in der vorliegenden Fassung des Detmolder Gedenkbuches nachvollziehen. Nach aktuellem Stand vom Mai 2024 sind inzwischen 225 Biogramme im Detmolder Gedenkbuch dokumentiert, finden sich aber nicht vollständig auf der Gedenktafel aus dem Jahr 2013. Hier finden sich lediglich 173 Namen von Verfolgten. Insofern ist eine Ergänzung bzw. Umgestaltung der Tafel notwendig und geboten. Auf der derzeitigen Gedenktafel findet sich zudem der Name von Herbert Levi, was den ursprünglich zugrunde gelegten Aufnahmekritierien nicht entspricht. Weitere Recherchen ergaben allerdings, dass der ehemalige Schüler der jüdischen Volksschule in Detmold überlebte, heiratete, eine Familie gründete und 2006 oder 2007 verstarb, ohne je Zeugnis über seinen Lebenweg abgelegt zu haben. Aus Gründen des Datenschutzes kann seine Biografie jedoch noch nicht veröffentlicht werden.
Die hier vorliegende Form der Onlineversion des Gedenkbuches ist unter anderem einer vollkommen veränderten digitalen Quellenlage geschuldet, da die Dokumente in fast allen Archiven und Gedenkstätten auch in digitaler Form vorliegen und Datenbanken einen umfassenden, direkten Zugriff auf Informationen und Quellen ermöglichen. Eine herausragende Position nehmen in diesem Zusammenhang die Arolsen Archives - International Center on Nazi Persecution (kurz: Arolsen Archives; bis Mai 2019 International Tracing Service Bad Arolsen, kurz: ITS) - ein, dessen digitalisierten und indizierten Bestände seit 2007 auch der Wissenschaft zugänglich gemacht wurden. Durch diese in den Arolsen Archives verfügbaren Bestände und Informationen erfuhr auch das Detmolder Gedenkbuch eine umfassende Erweiterung und Vertiefung der bislang vorliegenden Forschungsergebnisse. So konnten die Kenntnisse über einen großen Teil der Lebensläufe von Detmolder Opfern überarbeitet, korrigiert und ergänzt werden. Die nahezu vollständige Auslöschung von Lebenslinien durch den NS-Staat wird auch in dieser Dokumentation deutlich, da sich zu manchen der Betroffenen weder in den Beständen der Arolsen Archives, noch in anderen Gedenkstätten, Archiven oder auch Onlineportalen Informationen oder gar Dokumente ermitteln ließen, die den jeweiligen Lebensweg hätten aufklärend beleuchten oder ergänzen können. So bleiben für diese Menschen nur noch ihren Namen und allenfalls rudimentäre Hinweise auf wenige Spuren, die sie hinterlassen haben.
Die Onlinefassung des Gedenkbuches bietet durch die digitalen Informationsmöglichkeiten einer weitaus größeren Öffentlichkeit als bisher den Zugang zu Forschungsergebnissen und Dokumenten der Detmolder Verfolgten und Ermordeten der NS-Gewaltherrschaft. Auch die durch die sich ständige verändernde Quellenlage können und werden die notwendigen fortlaufenden Ergänzungen und Korrekturen des aktualisierten Gedenkbuches auf diese Weise zeitnah veröffentlicht und können jederzeit abgerufen werden.So konnten die einzelnen biographischen Beiträge u. a. durch die Einwohnermeldekarten der Stadt Detmold ergänzt werden, die für die Druckfassung in dieser Form noch nicht zur Verfügung standen und detaillierte Auskünfte über die einzelnen Personen und ihre Wohnorte bieten. Die auf manchen Meldekarten handschriftlich hinzugefügten zusätzlichen Notizen und Anmerkungen erlauben Einblicke nicht nur in die Methoden des NS-Überwachungsstaates. Sie geben auch Auskünfte über Diffamierungen, etwaige Haftstrafen sowie über einzelne Stationen der jeweiligen Lebenswege.
Opfergruppen
Zu den hier bislang aufgenommenen Opfergruppen zählen
- Jüdinnen und Juden, die die weitaus größte Opfergruppe auch in Detmold darstellen
- politisch Verfolgte
- als „arbeitsscheu“ und „asozial“ Verfolgte, in der NS-Nomenklatur „Arbeitsscheu Reich“ genannt
- Opfer der „Euthanasie“
- Zeugen Jehovas bzw. Bibelforscher
- Sinti und Roma
- Deserteure
und auch - Opfer der NS-Justizverbrechen.
Erklärtes Ziel des Detmolder Gedenkbuches ist eine wissenschaftlich fundierte und belegbare Dokumentation und Aufklärung. Die Dokumentation dieser Schicksale ist als ein Teil einer Erinnerungskultur zu verstehen, die sich bewusst und empathisch mit einzelnen Lebens- und Leidenswegen auseinandersetzt. Dabei gilt es, eine Hierarchisierung und Kategorisierung der Opfer in „schuldig“ und „unschuldig“ nicht fortzuschreiben und sich dem hinlänglich bekannten Konkurrenzkampf der Opfer zu entziehen, in dem sich Juden und politisch aktive Widerstandskämpfer, als „asozial“ Verfolgte und Kriminelle, Sinti und Roma um Anerkennung ringend gegenüber stehen. Eine Dokumentation der als Homosexuelle Verfolgten steht noch aus.
Im Zentrum des Detmolder Gedenkbuches stehen zum größten Teil Menschen jüdischer, aber auch christlicher Religionszugehörigkeit, Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt, Nachbarn, Geschäftspartner, Repräsentanten des öffentlichen Lebens sowie politisch Engagierte, die in Detmold geboren wurden und/oder gelebt haben. Es finden sich zudem Menschen, die hier nur zeitweise wohnten, etwa weil sie zu Besuch waren, und sich aber ab 1939 offiziell in den Detmolder Einwohnermeldebehörden registrieren lassen mussten. Sie alle fielen dem nationalsozialistischen Terror zum Opfer und erlebten das Ende der Diktatur nicht mehr oder sie überlebten schwer an Körper und Seele geschädigt und traumatisiert. Sie erlebten Diskriminierung, Ausgrenzung, die Zerstörung ihres sozialen Umfeldes und Bezugsrahmens, berufliche Benachteiligung bis hin zum Berufsverbot, Verfolgung und Inhaftierung sowie den Verlust der bürgerlichen Rechte. Manche wurden Opfer der Rechtsprechung im NS-Unrechtsstaat.
Insbesondere die Jüdinnen und Juden erfuhren auch in Detmold eine Dimension der Gegenmenschlichkeit, deren Ausmaß in Begriffen wie "Zivilisationsbruch" und "eines der größten Menschheitsverbrechen" nur unzureichend und floskelhaft zu fassen gesucht wird. Die jüdische Bevölkerung erlebte eine beispiellose systematische Entrechtung, Austreibung, Verarmung und Verfolgung. Sie wurden Opfer einer Politik, die sie von jeder Rechtstaatlichkeit ausschloss, sie zu Sklavenarbeitern machen konnte und ihnen letztlich jedes Recht auf Leben absprach und sie in den Konzentrations- und Vernichtungslagern einen gewaltsamen und qualvollen Tod erleiden ließ. In Detmold wurden im Jahr 1933 rund 160 Menschen jüdischer Religionszugehörigkeit gezählt, die sich nun dem NS-Terror ausgesetzt sahen. Bereits im Februar 1933 wurden Fensterscheiben von Geschäftsleuten eingeworfen (s. hierzu Otto Baer), Verhaftungen unter der Führung des SS-Sturmbannführer Stroop folgten, deren bekanntestes Opfer Felix Fechenbach war, Boykottierungen, sog. Einzelaktionen und alltägliche Schikane zersetzten das Leben der jüdischen Gemeinde. Bereits im Vorfeld der Nürnberger Rassegesetzgebung wurde David Boehm im Sommer 1935 wegen einer harmlosen Unterhaltung mit einer jungen Frau der sog. Rassenschande bezichtigt und durchlitt nicht nur eine Diffamierungskampagne durch die lippische Presse, sondern wurde in das Konzentrationslager Esterwegen eingewiesen. David Boehm starb an den Folgen der Haft nur kurze Zeit nach seiner Rückkehr nach Detmold.
Die jüdische Gemeinde galt als liberal bzw. assimiliert, und nur sehr wenige gehörten der Gruppe der sog. Ostjuden an, die Anfang des 20. Jahrhunderts vor den Pogromen in Russland und Polen geflohen waren. Am 28. Oktober 1938 erließ die polnische Regierung eine Verordnung, nach der die Auslandspässe der im Ausland lebenden polnischen Staatsangehörigen zu ihrer Gültigkeit einen Kontrollvermerk benötigten. Andernfalls drohte die Ausbürgerung. Dies war willkommener Anlass und Möglichkeit für die Reichsregierung, die polnischen Juden loszuwerden. Diese „Polenaktion“ genannte Ausweisung betraf reichsweit etwa 17.000 Menschen. In Detmold waren Josef Leib Vogelhut und seine Schwester Recha ebenso davon betroffen wie Regina Bonom-Horowitz. Sie wurden über Hannover mit der Reichsbahn zur polnischen Grenze geschafft und in das Flüchtlings- und Durchgangslager Zbaszyn eingewiesen. Die polnischen Behörden weigerten sich, die ausgewiesenen Juden aufzunehmen. Anträge auf Wiedereinreise von Vogelhut und Bonom-Horowitz, um wenigstens ihre Geschäfte liquidieren zu können, wurden abgelehnt. Nur Anna Vogelhut blieb in Detmold, bis auch sie im Juli 1939 Deutschland verlassen musste.
Viele Detmolder Jüdinnen und Juden waren älter als 45 Jahre, so dass die Gemeinde als „überaltert“ galt. Nach den Ausschreitungen des Novemberpogroms (s. Hartmann (1998)) wurden aus Lippe am 11. November 1938 45 Männer in das Konzentrationslager Buchenwald deportiert. Für viele gab es nach ihrer Rückkehr nur noch das Ziel, Deutschland möglichst schnell zu verlassen. Die wirtschaftliche Existenz der jüdischen Bevölkerung wurde systematisch durch Liquidation oder Zwangsarisierung der Betriebe (in Detmold betraf dies z.B. die Möbelfirma Neugarten und Eichmann oder das Kaufhaus Alsberg) zerstört. Die Verarmung der Menschen war logische und staatlich gewollte Konsequenz.
Den Auswanderungswellen insbesondere nach dem Novemberpogrom schlossen sich vorrangig Jüngere an, die bereit waren, ihre Heimat zu verlassen und im Ausland eine neue Existenz aufzubauen. Die Älteren hingegen fühlten sich Detmold und ihrem bisherigen Leben so stark verbunden oder waren durch Alter und Gesundheit nicht in der Lage, eine Auswanderung auf sich zu nehmen, so dass sie trotz der täglichen Bedrohung blieben bzw. bleiben mussten. Von 1939 bis zum Winter 1941/42 lebten in Detmold noch etwa einhundert Jüdinnen und Juden.
Ab dem 30. April 1939 mussten die jüdischen Bürgerinnen und Bürger ihre Wohnungen und Häuser verlassen und wurden zwangsweise in sog. Judenhäuser eingewiesen. Die Verordnung über den Einsatz des jüdischen Vermögens (Reichsgesetzblatt I, S. 1709) vom 3. Dezember 1938 hatte jüdische Hauseigentümer verpflichtet, ihre Immobilien zu verkaufen. Das Gesetz über Mietverhältnisse mit Juden (Reichsgesetzblatt I, S. 864) vom 30. April 1939 lockerte den Mieterschutz für Juden, da es „dem nationalsozialistischem Rechtsempfinden widerspräche, wenn deutsche Volksgenossen in einem Hause mit Juden zusammenleben müssten“. Jüdische Mieter konnten dazu gezwungen werden, weitere Juden als Untermieter in ihre Wohnung aufzunehmen. Die Diskriminierung und Entrechtung der jüdischen Bevölkerung erreichten damit wiederum eine neue Dimension. Zudem erleichterte die Konzentrierung der Menschen auf engstem Wohnraum den NS-Behörden die späteren Transporte in die Ghettos und Konzentrationslager. In Detmold gab es sieben sog. Judenhäuser, die sich in der Sachsenstraße 4, 4a und 25, in der Paulinenstraße 6 und 10, sowie in der Hornschen Straße 33 und in der Gartenstraße 6 befanden. (s. Mitschke-Buchholz (2008)) Die Registrierung durch die Einwohnermeldebehörde für die einzelnen Häuser stellt deutlich die unwürdige Enge vor Augen, in der die Menschen zu leben gezwungen waren.
Am 18. November 1938 wurde von der Landesregierung Lippe wie überall im Reich angeordnet, dass alle jüdischen Schülerinnen die deutschen Schulen zu verlassen hätten, da es keinem deutschen Lehrer und keiner deutschen Lehrerin mehr zuzumuten sei, jüdische Schüler zu unterrichten und es für deutsche Schüler nicht mehr tragbar sei, mit Juden die gleiche Schulbank zu benutzen (Erlass des Reichsstatthalters in Lippe und Schaumburg-Lippe vom 18.11.1938, Staatsanzeiger für das Land Lippe 1938, S. 409). Zunächst wurden die fünfzehn jüdischen Schülerinnen und Schüler in Lippe vom jüdischen Religionslehrer Max Alexander unterrichtet. In der Gartenstraße 6 wurde dann aber wohl von der Synagogengemeinde Detmold eine private jüdische Schule eingerichtet, die vom 1. Oktober 1939 an von der Reichsvereinigung der Juden in Deutschland weitergeführt wurde. (s. Müller (1998), Müller (2008)) Hier unterrichteten wiederum Max Alexander, Hedwig Block (Englisch), Auguste Michaelis-Jena (Handarbeit) und der Synagogendiener und Buchbinder Louis Flatow (Werkunterricht). 1940 zählte die Schule siebzehn Schülerinnen und Schüler, 1941 kamen noch fünf weitere hinzu. Der Einzugskreis bezog sich nicht nur auf Lippe, sondern auch auf Nachbargebiete wie Höxter, Nieheim, Ovenhausen, Amelunxen, Bad Driburg, Beverungen sowie Borgholz, Brilon, Korbach und Rohden in Waldeck. Die Kinder wurden bei Gasteltern, sog. Pensionseltern (z.B. Herzberg, Valk oder auch Paula Paradies) untergebracht und lebten die letzten beiden Jahren vor ihrer Deportation von ihren Familien getrennt. Mit Beginn der Deportationen im Dezember 1941 lichteten sich ihre Reihen, da die Kinder nach Hause gerufen wurden, um zusammen mit ihren Angehörigen in das Ghetto in Riga verschleppt zu werden. Seit dem 19. September 1941 waren auch sie gezwungen, den sog. Judenstern zu tragen. Ausgenommen hiervon waren lediglich die in sog. Mischehe lebenden Juden. Am 7. Juli 1942 wurde „jegliche Beschulung jüdischer Kinder“ durch die Reichsregierung verboten. Zu diesem Zeitpunkt gab es die jüdische Schule in Detmold bereits nicht mehr, da die Lehrer Max Alexander, Hedwig Block und auch Louis Flatow nach Warschau deportiert worden waren. Bereits während des Schulunterrichts wurde in der Gartenstraße 6 ein jüdisches Altersheim eingerichtet, das von Auguste und Bernhardine Michaelis-Jena geleitet wurde. Träger dieses Heims waren die „Jüdischen Kultusvereinigung Detmold“ und die „Bezirksstelle Westfalen der Reichsvereinigung der Juden in Deutschland mit Sitz in Bielefeld“. Am 28. Juli 1942 wurden die hoch betagten und gebrechlichen Bewohner des Altersheims zunächst auf dem Detmolder Marktplatz gesammelt und dann über Bielefeld nach Theresienstadt deportiert. Manche von ihnen überlebten nur wenige Wochen.
Den Deportationen der jüdischen Menschen aus Lippe und Detmold lagen verwaltungstechnische Vorgänge zugrunde, die in viele Einzelschritte unterteilt waren (s. Hartmann (1998)). Die Deportationslisten wurden für Detmold von der Gestapo-Außenstelle Bielefeld zusammengestellt. Abfahrtszeiten und Ziele des jeweiligen Transports wurden dieser von der Leitstelle in Münster ebenso mitgeteilt wie auch die Anzahl der aus dem Gestapo-Bezirk zu stellenden Personen. Die Reichsvereinigung der Juden in Deutschland (Bezirksstelle Bielefeld) wurde zur Vorbereitung der Abtransporte von der Gestapo Bielefeld gezwungen. Die Reichsvereinigung gab die Direktiven für die Deportationen aus Lippe an das Detmolder Büro weiter, das sich in der Hornschen Straße 33 befand und damit in einem der Detmolder sog. Judenhäuser. Eduard Kauders hatte die Leitung des Büros übernommen, Moritz Herzberg war sein Vertreter. Beide sahen sich gezwungen, ein Rundschreiben der Bielefelder Reichsvereinigung der Juden in Deutschland mit genauen Anweisungen für den Transport an die Detmolder Gemeindemitglieder weiterzuleiten. Hierin wurden nicht nur der Zeitpunkt der Deportation mitgeteilt, sondern auch Anweisungen zum Verlassen der Wohnungen und zum mitzunehmenden Gepäck gegeben, was auch den Anschein eines sog. Arbeitseinsatz unterstützte. Fieberhaft stellten die Betroffenen daraufhin nicht nur persönliches Gepäck zusammen, sondern Handwerkszeug und Gerätschaften, die sie glaubten, in Arbeitseinsätzen gebrauchen zu können. Diese Mitteilung wurde zunächst wenige Wochen vor dem Transport übermittelt, später waren es nur noch wenige Tage.
Die erste Deportation aus dem Gestapo-Bezirk Bielefeld, zu dem auch Detmold gehörte, erfolgte am 13. Dezember 1941 nach Riga. Spätestens am 20. November 1941 hatten die 25 lippischen Betroffenen die Nachricht ihrer bevorstehenden „Umsiedlung“ erhalten, die den Anschein vermitteln sollte, es handelte sich um eine Umsiedlungsaktion oder einen Arbeitseinsatz, da etwa auch Handwerkszeug zugelassen worden war. Zunächst wurden sie im Veranstaltungs- und Versammlungshaus Kyffhäuser in Bielefeld, das nun als Sammelstelle diente, unter unwürdigsten Umständen festgehalten, ihrer Papiere und Habe beraubt und nach drei qualvollen Tagen vom Bahnhof Bielefeld mit Personenwagen dritter Klasse nach Riga deportiert.
Die zweite Deportation von Detmolder Jüdinnen und Juden fand am 31. März 1942 von Bielefeld in das Warschauer Ghetto statt. Die offizielle Abmeldung erfolgte drei Tage zuvor und wurde mit den Formulierungen „nach unbekannt abgemeldet“ oder „mit unbekanntem Ziel ausgewandert“ in den Unterlagen der Einwohnermeldebehörde vermerkt. Am 20. März 1942 hatte die Gestapo den Abtransport von 1000 Juden aus dem Bezirk der Stapoleitstelle Hannover, dem 325 Jüdinnen und Juden aus dem Gestapobezirk Bielefeld angegliedert werden mussten, mitgeteilt. Dieser Transport erfolgte nun in Viehwaggons vom Bielefelder Güterbahnhof. Sieben Jüdinnen und Juden aus Lippe wurden am 8. Juli 1942 nach Auschwitz deportiert. Keiner von ihnen überlebte.
Am 31. Juli 1942 sollten laut Mitteilung der Gestapo Bielefeld 925 Menschen aus dem Bezirk der Stapoleitstelle Münster, wie es hieß, „evakuiert“ werden. Ziel dieser Deportation war Theresienstadt, das als „Musterghetto“ ausländischen Delegationen und Diplomaten vorgeführt wurde und als sog. Alters- und Vorzeigeghetto diente. Allerdings war Theresienstadt für viele ein Durchgangslager, das nur die erste Station war und sie nach Treblinka, Sobibor, Belzec, Majdanek oder Auschwitz in den sicheren Tod führte. Diejenigen, die sich auf der Deportationsliste für diesen Transport befanden, mussten sich am 28. Juli 1942 auf dem Detmolder Marktplatz einfinden, wurden dort auf Lastwagen geladen und mit dem Zug nach Bielefeld gebracht, wo sie wiederum in der Sammelstelle Kyffhäuser ausharren mussten, bis sie drei Tage später vom Güterbahnhof Bielefeld nach Theresienstadt verschleppt wurden. Unter ihnen waren auch die hoch betagten Bewohner des jüdischen Altersheims, das sich in der Gartenstraße 6 befunden hatte. Die Anzahl derer, die aus Detmold nach Theresienstadt mit dem Transport Nr. XI/1 deportiert wurden, ist mit 44 Personen größer als die Zahl derer, die nach Warschau verschleppt wurden.
Die vierte Deportation aus Detmold betraf sog. Mischehepartner und sog. Mischlinge 1. Grades und erfolgte am 19. September 1944. 23 Personen aus Lippe wurden in die Zwangsarbeitslager der Organisation Todt nach Elben bei Kassel bzw. nach Zeitz verschleppt. Sie überlebten.
Noch am 20. Februar 1945 kamen 58 Juden aus dem Bezirk Münster in Theresienstadt an. Fünf von ihnen stammten aus Lippe und gehörten der Gruppe der „Mischehepartner“, „jüdischen Mischlinge“ und sog. Geltungsjuden an, die zu einem „Arbeitseinsatz“ nach Theresienstadt verschleppt wurden. Kurze Zeit später wurden sie von den Truppen der Roten Armee befreit.
Menschen, die in ihrer Lebensführung den Vorstellungen der Machthaber widersprachen wurden als „asozial“ diffamiert, als „Bedrohung des gesunden Volkskörpers“ aus der Gesellschaft ausgeschlossen und der Verfolgung preisgegeben. Zu dieser Verfolgtengruppe gehörten etwa Wohnungslose, Bettler, Landstreicher, Zuhälter, Prostituierte, Fürsorgeempfänger*innen und auch "Zigeuner und nach Zigeunerart umherziehende" Personen. Der Begriff "Asoziale" wurde unter den Nationalsozialisten als Sammelkategorie zur Verfolgung sozialer Außenseiter genutzt, so z. B. bei der groß angelegten Massenverhaftung der Aktion "Arbeitsscheu Reich" im Jahr 1938. Die Häftlingskategorie AZR stand für "Arbeitszwang Reich" und betraf häufig Personen, die als "asozial" verhaftet wurden. Fallstudien zeigen, dass die Todesrate von als "asozial" Verfolgten und Inhaftierten - sie erhielten in den Konzentrationslagern den schwarzen Winkel als Kennzeichen - sehr hoch war. Viele Opfer der Aktion "Arbeitsscheu Reich" im Sommer 1938 wurden in den folgenden Jahren immer wieder in andere Konzentrationslager überstellt, viele von ihnen starben kurz nach der Ankunft in ihnen bislang unbekannten Lagern. "Die sehr hohen Todesraten sind ebenso schockierend wie der Blick auf Einzelschicksale", so Henning Borggräfe, Abteilungsleiter Forschung und Bildung der Arolsen Archives in einem Interview aus dem Jahr 2020. In den Debatten seit den 1980er Jahren stand die Gruppe der als "asozial" Verfolgten ebenso wie die der sog. Berufsverbrecher auch in den Debatten über sog. vergessene Opfer eher am Rande. Deren KZ-Haft galt lange nicht als nationalsozialistisches Unrecht, und infolgedessen waren die Betroffenen von Entschädigungsleistungen ausgeschlossen. Von einer vollständigen gesellschaftlichen und politischen Anerkennung als Verfolgte des NS-Terrorregimes sind sie - so steht zu befürchten - auch nach jahrzehntelanger Diskussion, in der das gesellschaftliche Verständnis von nationalsozialistischem Unrecht nur schrittweise erweitert wurde, noch immer weit entfernt - zumal ein Konsens darüber aktuell brüchiger zu werden scheint. Viele der Betroffenen verschwiegen und verschweigen bis heute ihre Konzentrationslager-Haft oder zumindest die Farbe ihres Häftlingswinkels, nach wie vor aus Angst vor Stigmatisierung und angesichts fortdauernder Diskriminierungen. Auch innerhalb eines Familienverbandes wurde die Konzentrationslager-Haft, die Verfolgung als "Asozialer" eines Verwandten auch aus Sorge vor Stigmatisierung tabuisiert. Erst eine Anhörung von Experten und Expertinnen im Bundestag im Herbst 2019 führte dazu, dass im Februar 2020 die Regierungsmehrheit den Antrag von SPD und CDU/CSU annahm, nach dem die von den Nationalsozialisten als "Asoziale" und "Berufsverbrecher" bezeichneten Häftlinge als Opfer der NS-Gewaltherrschaft anerkannt werden sollen. In den Anträgen und Diskussionen lautete der wohl wichtigste Satz: "Niemand wurde zu Recht in einem Konzentrationslager inhaftiert, gequält oder ermordet." Diese sehr späte gesellschaftliche Rehabilitierung der ehemaligen Häftlinge ist sehr wichtig für die wenigen noch lebenden Verfolgten und auch für deren Familien. Denn Ausgrenzung über Jahrzehnte hinweg erschwert den Umgang mit der Geschichte, die, als "dunkles Geheimnis" gehandelt, ihre Wirkmächtigkeit bis heute entfalten kann.
Auch geistig, körperlich und psychisch Kranke galten als "Ballastexistenzen" und als Bedrohung für den "gesunden Volkskörper" und sollten aus der "Volksgemeinschaft" durch das „Euthanasie“ genannte Ermordungsprogramm entfernt werden. Sie wurden als „lebensunwert“ vernichtet oder deren Tod wurde durch Unterlassung billigend in Kauf genommen. Zwischen 200.000 und 400.000 Menschen mit geistiger und/oder körperlicher Behinderung, Kranke, Autisten und Kinder, die als "Idioten" eingestuft und herabgewürdigt wurden, wurden bis 1939 zwangssterilisiert. Ab 1939 und inoffiziell bis zum Kriegsende wurden etwa 200.000 Menschen im Rahmen des "Gnadentod" genannten systematischen Ermordungsprogramm durch Vergasung, Giftinjektionen oder Unterernährung getötet. Ziel war es, den Anteil der als gesund und rassisch "wertvoll" Geltenden an der "Volksgemeinschaft" durch eine - wie es hieß - "unsentimentale Vernichtung aller Kranken und Schwachen zu vergrößern. Neben rassehygienischen Vorstellungen der Eugenik galten auch kriegswirtschaftliche Erwägungen während des Zweiten Weltkriegs als Begründung der "Vernichtung lebensunwerten Lebens". So wurde argumentiert, dass die "Anstaltsinsassen" nicht besser als die für das Vaterland Kämpfenden und Sterbenden behandelt werden dürften. Die Kranken mussten insofern für diese "besseren Deutschen" zusammenrücken, Platz machen oder mit ihrem frühzeitigen Tod "bezahlen", sofern sie nicht gequält, verachtet und ermordet wurden. Die Utopie der Menschenzüchtung mit dem Ziel einer Gesellschaft ohne Kranke und Schwache führte zu einer willkürlichen und gegenmenschlichen Einteilung von Menschen, deren Tod geplant, gesellschaftlich gewollt und systematisch durchgeführt und deren qualvolles Sterben menschenverachtendes Kalkül war. Auch diese Opfergruppe, die Schwächsten und Wehrlosesten einer Gesellschaft, deren Behandlung und Umgang das Wesen und die Struktur einer Gesellschaft dokumentiert und offenlegt, sind auch für Detmold während der NS-Zeit in den Blick genommen worden. Da die Wahrung der Würde und Integrität der Betroffenen und bei der Quellengattung Krankenakten die schutzwürdigen Belange Dritter in den Vordergrund treten, wurde bewusst auf die Nennung der Diagnose verzichtet. Menschen mit psychischen und geistigen Erkrankungen wurden hier aus der Region in Einrichtungen wie den von Bodelschwinghschen Anstalten-Bethel, der Heil- und Pflegeinrichtung Eben-Ezer oder der Heil- und Pflegeanstalt Lindenhaus untergebracht und allenfalls "verwahrt", bevor sie von teils mehreren Verlegungen, die ihre Spuren verwischen und sollten, in Tötungsanstalten betroffen waren oder durch eine unethische und vorsätzlich unsachgemäße medizinische Unterversorgung, gezielte Mangelernährung und Vernachlässigung einem langen Sterben ausgeliefert wurden.
Zu den eher „vergessenen“ Verfolgtengruppen gehören auch Menschen, die zu den Opfern der NS-Justizverbrechen zählen. Der NS-Strafvollzug stand außerhalb der Rechtsordnung. Insofern sind die als „Verbrecher“ oder als sogenannte Gewohnheitsverbrecher Inhaftierten und Ermordeten hier als Verfolgte des Terrorregimes dokumentiert. Als ein Teil der NS-Justizverbrechen traten die sog. Sondergerichte hervor, die außerhalb der ordentlichen Gerichtsbarkeit standen. Diese sind durch die massenhafte Verhängung von Todesstrafen bzw. langjährigen Zuchthausstrafen und/oder auch Inhaftierungen in Konzentrationslagern wegen meist geringfügiger Delikte bekannt. So wurde z. B. Leo Wilczynski nach kleineren Taten durch das Sondergericht Hannover als sog. Volksschädling wegen seiner „besonders großen verbrecherischen Gesinnung“, wie es im Urteil hieß, zweimal zum Tode verurteilt und im Strafgefängnis Wolfenbüttel hingerichtet.
Sondergerichte gab es in Deutschland bereits vor der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten im Jahr 1933. So konnte der jeweilige Militärbefehlshaber im Königreich Preußen 1851 aufgrund des Gesetzes über den Belagerungszustand Sondergerichte einrichten. Dies kam allerdings erst im Ersten Weltkrieg zur Anwendung. In der Weimarer Republik wurden mehrfach aufgrund von Notverordnungen Sondergerichte mit unterschiedlichen Befugnissen und Verfahrensordnungen eingerichtet. Auch hier wurden ganze Komplexe von Straftatbeständen aus der ordentlichen Gerichtsbarkeit herausgelöst und diesen speziell eingerichteten Spruchkörpern zugewiesen. Auch die Reichsregierung unter Franz von Papen ordnete im Anschluss an die Notverordnungen „gegen den politischen Terror“ vom 9. August 1932 die Einrichtung von Sondergerichten in Oberlandes- und Landesgerichtsbezirken an. Diese Verfahren waren ebenfalls durch massive Einschränkungen elementarer Verteidigungsrechte und den Ausschluss von Rechtsmitteln gekennzeichnet. Mit Wirkung zum 21. Dezember 1932 wurden diese Sondergerichte aufgehoben. Auf diese unrechtmäßige Tradition setzten die nationalsozialistischen Machthaber zur Durchsetzung ihrer verbrecherischen Herrschaft auf: Bereits am 21. März 1933 wurde reichsweit für jeden Oberlandesgerichtsbezirk ein Sondergericht eingerichtet, insgesamt waren dies 26. Ende 1942 existierten insgesamt 74 Sondergerichte, deren Zuständigkeit mehrfach erweitert wurde und die großen Gruppen der Bevölkerung auch einen nur rudimentären Rechtsschutzanspruch verweigerten und sie einer von vornherein völligen Willkür auslieferten. In dieser gnadenlosen Spruchpraxis hatte das Sondergericht u. a. freies Ermessen, ob und welche Beweise es zum Nachweis des Tatvorwurfs erheben wollte. Der z. T. wegen kleinster Delikte Verurteilte hatte gegen das Urteil keinerlei Rechtsmöglichkeiten. Es oblag nur der Staatsanwaltschaft die sog. Nichtigkeitsbeschwerde einzulegen, die jedoch fast immer nur zu Ungunsten des Verurteilten ausgelegt wurde. Die erheblichen Strafverschärfungen bewirkten einen massiven Anstieg der Zahl der verhängten Todesstrafen. Schätzungen zufolge wurden etwa 16.500 Todesurteile gefällt, davon wohl 11.000 durch die Sondergerichte. Teil dieser Rechtssprechung war auch die Anordnung der Sicherungsverwahrung, die auf dem am 24. November 1933 erlassenen Gewohnheitsverbrechergesetz („Gesetz gegen gefährliche Gewohnheitsverbrecher und über Maßregeln der Sicherung und Besserung“) beruhte. Auch hier wurden Pläne aus der Weimarer Republik durch die Nationalsozialisten erheblich verschärft und durch ideologische Überlegungen aus der sog. Kriminalbiologie begründet. Wiederholungstäter konnten, wenn sie als „gefährliche Gewohnheitsverbrecher“ – für diese Kategorisierung lag keine eindeutige Definition vor – eingeschätzt wurden, zu drakonischen Strafen verurteilt werden. Die unbefristete Sicherungsverwahrung wurde verhängt, wenn „die öffentliche Sicherheit“ es erforderlich machte. Die Sicherungsverwahrung schloss sich an die ursprüngliche Freiheitsstrafe an, wobei das zuständige Gericht im Abstand von drei Jahren über deren Fortdauer entschied.
Im Laufe des Zweiten Weltkriegs verschärften sich die ohnehin erschwerten Bedingungen für die Sicherungsverwahrten nochmals, als Reichsjustizminister Otto Georg Thierack im Sommer 1942 nach Verhandlungen mit hochrangigen SS-Offizieren die Vereinbarung traf, als Schwerverbrecher Kategorisierte an die Polizei zur „Vernichtung durch Arbeit“ in den Konzentrationslagern der SS zu überstellen. So wurden zwischen Herbst 1942 und Sommer 1943 etwa 15.000 Gefangene an die Polizei übergeben. Etwa die Hälfte davon waren sog. gefährliche Gewohnheitsverbrecher aus der Sicherungsverwahrung. Die meisten von ihnen wurden in den Konzentrationslagern ermordet. Es gilt als wahrscheinlich, dass etwa die Hälfte von ihnen innerhalb von drei Monaten nach ihrer Einlieferung dort umkam. Über Jahrzehnte galt die KZ-Haft von sog. Berufsverbrechern (Im Lager waren diese Häftlinge durch einen grünen Winkel in der Haftkategorie BV gekennzeichnet, dies war eigentlich eine Abkürzung für "befristeter Vorbeugehäftling". Seit 1937 wurden Menschen im Zuge der sog. "vorbeugenden Verbrechensbekämpfung" in Konzentrationslager eingeliefert, in der Annahme, dass sie "auch in Zukunft strafbare Handlungen vornehmen" würden.) nicht als nationalsozialistisches Verbrechen und wurde demzufolge auch nicht entschädigt. Dem Begriff des "Berufsverbrechers" lag eine schon vor der NS-Zeit im kriminalistischen System verankerte Vorstellung zugrunde, nach der es Menschen gebe, die mit Verbrechen ihren Lebensunterhalt bestreiten würden. Auch diese Menschen sollten aus der "Volksgemeinschaft" entfernt werden. Erst im Februar 2020 stimmte der Bundestag einem Antrag zu, nach dem die sog. Berufsverbrecher als "Opfer des nationalsozialistischen Unrechtssystems" anerkannt und verstärkt in die Erinnerung und das öffentliche Gedenken einbezogen werden sollen.
Die Unverhältnismäßigkeit von Strafe und Tat sowie die Vorenthaltung elementarer Grundrechte des Strafverfahrens, die eine exzessive Auslegung der ohnehin menschenrechtswidrigen NS-Gesetze ermöglichten, verdeutlichen, dass die Sondergerichte als Teil des nationalsozialistischen Unrechtsstaates anzusehen sind. Erst 1998 wurden diese Urteile der Sondergerichte durch das Gesetz zur Aufhebung nationalsozialistischer Unrechtsurteile in der Strafrechtspflege aufgehoben. Das kurz NS-Unrechtsurteileaufhebungsgesetz genannte Gesetz schloss mit seinen Änderungen 2002 endlich auch die Aufhebung der Urteile gegen Deserteure der Wehrmacht, Homosexuelle und im Jahre 2009 sog. Kriegsverräter mit ein.
Die Zeugen Jehovas gehören noch immer zu den sogenannten „vergessenen Verfolgten“ des Nationalsozialismus. Auch heute noch ringen sie um die öffentliche Wahrnehmung und Anerkennung als Opfergruppe des Terrorregimes. Einer breiteren Öffentlichkeit ist das Schicksal der Zeugen Jehovas in der NS-Zeit weitestgehend unbekannt. Auch innerhalb der Forschung standen sie lange Zeit eher im Abseits und stießen oftmals auf Ressentiments und eine deutliche Abwehrhaltung. Erst seit den 1990er Jahren hat sich das geschichtswissenschaftliche Interesse an den Zeugen Jehovas gewandelt. Die Öffnung für die Erforschung und Dokumentation von Verfolgtenschicksalen seitens der Zeugen Jehovas ließ ebenso lange auf sich warten und gestaltet sich bis heute eher schwierig. Mehrere Kontaktversuche zum Geschichtsarchiv der Zeugen Jehovas für die Erforschung von Detmolder Verfolgten und deren Leidensweg blieben letztlich erfolglos. Im Detmolder Gedenkbuch können nun dennoch Lebenswege von verfolgten Zeugen Jehovas aus Pivitsheide dokumentiert werden. Mit der Familie Höveler ist ein Anfang des Gedenkens an Betroffene dieser Verfolgtengruppe gemacht.
Bereits seit Anfang der 1920er standen die Zeugen Jehovas im Fokus antidemokratischer und antisemitischer Kräfte. Dies verschärfte und radikalisierte sich mit dem Regierungsantritt der Nationalsozialisten. So wurden Zeugen Jehovas bzw. Bibelforscher als christliche, pazifistische und dezidiert unpolitische Gemeinschaf, die zu keinem Zeitpunkt die NS-Herrschaft mit trug, von Beginn des Nationalsozialismus an verfolgt und ab 1933 als erste Religionsgemeinschaft verboten. Die Bezeichnung Bibelforscher wurde von den Nationalsozialisten vorrangig verwendet, da sie den jüdischen Gottesnamen Jehova und auch die Bezugnahme auf die hebräische Bibel ablehnten. Durch die Nationalsozialisten wurde die von ihnen unerwünschte Glaubensgemeinschaft als angeblich jüdische Sekte und Unterstützer des Kommunismus stigmatisiert. Aus den Reihen der Amtskirchen wurde dies von manchen goutiert.
Der pazifistische Widerstand der Zeugen Jehovas gegen das NS-Terrorregime war geschlossen und konsequent religiös begründet und wird in der Forschung als defensiv beschrieben. Zeugen Jehovas bestanden auf das Recht einer persönlichen Weltanschauung, die dem Nationalsozialismus diametral entgegen stand, und auf freie Religionsausübung. Rassismus und Antisemitismus lehnten die Zeugen Jehovas strikt ab. Die Auflehnung gegen die Diktatur zeigte sich in der Verweigerung des sogenannten Hitlergrußes, der Wahlen, der Mitgliedschaft in NS-Organisationen sowie der Beteiligung an Krieg, Gewalt und Rüstungsproduktion. Durch ihre Verweigerung jeglicher politischen Teilnahme entzogen sie sich der staatlichen Kontrolle. (Minninger (2001), S. 11) Auch unter dem massiven und gewalttätigen Druck der Machthaber ließen die meisten Mitglieder der Zeugen Jehovas nicht von ihren Überzeugungen. Alle nationalsozialistischen Rituale lehnten sie als „Götzendienst“ ab. Zeugen Jehovas solidarisierten sich aus ihrer christlichen Grundhaltung mit Menschen anderer Verfolgtengruppen und standen Betroffenen aus allen Gruppen bei. Ihre Widerständigkeit begriffen sie auch als Akte der religiösen, kulturellen Selbstbehauptung und als Verteidigung ihrer Identität. Durch groß angelegte Protestaktionen mit mehr als 100.000 Flugblättern versuchten sie, die Öffentlichkeit über den verbrecherischen Charakter des Nationalsozialismus aufzuklären. Auch durch Publikationen und durch internationale Kampagnen dokumentierten sie ihre Regimekritik, ihre Verurteilung des Angriffs auf Polen, den Krieg und die Verfolgung anderer Opfergruppen. Sie berichteten auch über die gegenmenschlichen Verhältnisse in Konzentrationslagern.
Jehovas Zeugen, wie seit 1931 die offizielle Selbstbezeichnung dieser christlichen Glaubensgemeinschaft lautet, nannten sich auch Internationale Bibelforscher und in Deutschland Ernste Bibelforscher. Mit Beginn des NS-Terrorregimes – zu diesem Zeitpunkt gab es in Deutschland etwa 25.000 bekennende Glaubensangehörige und ein Umfeld von ca. 10.000 Gläubigen – wurden sie systematisch verfolgt. Zu den Verfolgungsmaßnahmen gegen die Zeugen Jehovas gehörten bereits in den ersten Wochen der NS-Gewaltherrschaft Beschlagnahmungen, Hausdurchsuchungen, Sorgerechtsentzug, Verhaftungen, Verhöre, Inhaftierung und Folter. Auf Grundlage der sogenannten Reichstagsbrandverordnung („Verordnung des Reichspräsidenten zum Schutz von Volk und Staat“ vom 28. Februar 1933) erfolgten die Verbote der Glaubensgemeinschaft und ihrer Einrichtungen in den deutschen Ländern ab dem 10. April 1933. In Lippe erfolgte das Verbot am 3. Juli 19331 . Die bestehenden Ortsgruppen wurden aufgelöst, die Druckschriften der Internationalen Bibelforscher Vereinigung waren verboten. Bei Zuwiderhandlungen drohte eine Gefängnisstrafe nicht unter einem Monat oder eine Geldstrafe von 150-15.000 Reichsmark. Zeugen Jehovas und ihre Betätigungen wurden damit als staatsgefährdend diskreditiert und sie galten nunmehr als Staatsfeinde. Das Verbot der Internationalen Bibelforscher-Vereinigung in Preußen, dem weitaus größten Land, am 24. Juni 1933 markierte das faktisch reichsweite Verbot und führte damit zum Ende aller offiziellen Aktivitäten von Zeugen Jehovas im Deutschen Reich. Dieses Verbot wurde nachträglich auf dem Verwaltungsweg am 1. April 1935 ausgesprochen. Damit standen nicht nur Herstellung und Vertrieb von Schriften unter Strafe, sondern jegliche Betätigung im Sinne der Glaubensgemeinschaft. Zeugen Jehovas, auch in Lippe, reagierten mit einem verstärkten Missionsdienst ab 1934. Ab 1936 erfolgten reichsweite Verhaftungsaktionen, von denen auch die Familien Höveler betroffen waren. Im Zuge dieser „systematischen Aufrollung“ des IBV-Apparates wurden 122 Personen im Gestapobezirk Bielefeld festgenommen. 76 kamen in sogenannte Schutzhaft. Bei umfangreichen Durchsuchungen wurden nach Gestapo-Angaben etwa 25 Zentner Druckschriften beschlagnahmt. Die Zeugen Jehovas aus Detmold wurden ebenfalls von der Gestapo verhört, erkennungsdienstlich erfasst und wurden in Untersuchungshaft im Detmolder Landgerichtsgefängnis inhaftiert. Für viele war dies nur die erste Station. Es folgte ihre Inhaftierung im Bielefelder Polizeigefängnis in der Turnerstraße oder auch im Gerichtsgefängnis in Hannover, um dort vom Sondergericht abgeurteilt zu werden. In der zweiten Hälfte des Jahres 1937 erfolgte reichsweit eine weitere Verhaftungswelle. Nach dem Verbot der Glaubensgemeinschaft wirkten auch Zeuginnen Jehovas in hohem Maße und manche auch in Leitungsfunktionen an der Untergrundtätigkeit mit. Frauen waren dadurch in höherem Maße von den Verfolgungsmaßnahmen betroffen als bei anderen Gruppen der Regimegegner.
Die am 25. November 1939 erlassene „Verordnung zur Ergänzung der Strafvorschriften zum Schutz der Wehrkraft des deutschen Volkes“ trat beim juristischen Vorgehen gegen Zeugen Jehovas an die Stelle der „Reichstagsbrandverordnung“ vom 28. Februar 1933. Damit wurde auch die Gesinnung strafbar, nicht nur die Betätigung, noch dazu verbunden mit einer Strafverschärfung.
Die Forschung geht derzeit von einer Verfolgungsquote von etwa 50 - 60 % aus. So wurden demnach etwa 14.000 Zeuginnen und Zeugen Jehovas (mindestens 10.700 deutsche und 2.700 aus den besetzten Ländern Europas) Opfer der Verfolgung. Ca. 2.800 aus Deutschland und 1.400 aus dem besetzten Europa waren in den Konzentrationslagern in Haft und wurden dort misshandelt. Etwa 1.250 der Verfolgten waren Minderjährige. Die Bekämpfung der Zeugen Jehovas wirkte sich auch auf wirtschaftlicher Ebene aus, denn es erfolgten Berufsverbote gegen beamtete Bibelforscher und Angestellte im öffentlichen Dienst. Allein deren Zugehörigkeit zu der Glaubensgemeinschaft genügte in den meisten Fällen für eine Entfernung aus dem öffentlichen Dienst. Durch Druck auf private Arbeitgeber etwa durch die NS-Betriebsräte verloren Zeugen Jehovas ihre Arbeit. Von der öffentlichen Arbeitsvermittlung wurden sie jedoch ausgeschlossen: Arbeitsämter lehnten in vielen Fällen die Vermittlung in eine andere Arbeit ab. Privateigentum wurde konfisziert und Gewerbescheine verweigert bzw. widerrufen. Da die meisten auch in Lippe abhängige Arbeitnehmer waren, sahen sie sich massiv in ihrer Existenz gefährdet. Manche waren nach langer Inhaftierung vom Verlust nicht nur ihrer Arbeit, sondern auch ihrer Wohnung betroffen. Kürzungen bzw. Streichungen von Renten und Fürsorgebezügen trafen die Alten und Geschwächten und bedrohten systematisch auch deren Existenz. Etwa 600 Kinder wurden ihren Eltern durch den NS-Staat entzogen. Die Eltern verloren in diesem staatlich organisierten Kinderraub das Sorgerecht. Auch die Familie Höveler gehörten zu den Betroffenen dieses grausamen Repressionsmittels. Beide Familien wurden durch das Amt für Volkswohlfahrt des Kreises Lippe (Abteilung Wohlfahrt und Jugendhilfe Detmold) überwacht und massiv unter Druck gesetzt, ihre Kinder im Sinne des NS-Staates zu erziehen und in die „Volksgemeinschaft“ einzugliedern. Zu beklagen sind etwa 1.750 Todesopfer, davon 1.080 in Konzentrationslagern Ermordete und um ihr Leben Gebrachte, 385 wurden hingerichtet. Die aktuelle Forschung geht mittlerweile davon aus, dass die Zahl der Todesopfer mehr als 2.000 betragen könnte.
Zeugen Jehovas stellen die größte Gruppe von Kriegsdienstverweigerern im Nationalsozialismus dar. Bibelforscherinnen und Bibelforscher, die ihrem Glauben nicht abschworen, wurden durch Sondergerichte auf der Grundlage des NS-Heimtückegesetzes als Staatsfeinde verurteilt. Die Kriminalisierung der Bibelforscher und die Strafverfolgung erfuhren im Laufe der folgenden Jahre, insbesondere nach Kriegsbeginn 1939 eine radikale Verschärfung, die sich auch in unrechtmäßigen Verurteilungen durch Sondergerichte widerspiegelte. Für Zeugen Jehovas aus OWL waren zunächst die Sondergerichte Dortmund und Hannover zuständig, ab Dezember 1944 das Sondergericht Bielefeld. Funktionsträger und sogenannte Wiederholungstäter wurden durch die Gestapo in Konzentrationslager eingewiesen.
Seit 1935 – in diesem Jahr wurden viele Hunderte Zeugen Jehovas in die Konzentrationslager Esterwegen, Moringen und Sachsenburg verschleppt – bildeten die Bibelforscher-Häftlinge eine eigene, gesonderte Gruppe. Schon früh wurden sie durch die SS separiert, um die Missionsaktivitäten der Bibelforscher zu verhindern und die Möglichkeiten der Kontaktaufnahme zu anderen Gefangenen einzuschränken. Bereits ab 1936 waren Bibelforscher in den Lagern mit einem eigenen Kennzeichen stigmatisiert worden, bis ihnen ab 1938 im nun vereinheitlichten Kennzeichnungssystem der KZ der „lila Winkel“ zugewiesen wurde. Zeugen Jehovas sollten – anders als Jüdinnen und Juden – nicht systematisch vernichtet werden. Sie waren aber Misshandlungen, Schwerstarbeit, Krankheiten, Unterernährung, Schikane und dem allgegenwärtigen gewaltsamen Tod gnadenlos ausgeliefert.
Die Bibelforscher bzw. Zeugen Jehovas sind die einzige Verfolgtengruppe, die sich durch eine „Verpflichtungserklärung“, in der sie ihrem Glauben abschworen, sich zur Denunziation anderer Zeugen Jehovas und zur Eingliederung in die „Volksgemeinschaft“ verpflichteten, die Entlassung aus dem Konzentrationslager unter bestimmten Bedingungen hätten erwirken können. Trotz der qualvollen Haftbedingungen unterschrieben diese Erklärung nur wenige. Die Unbeugsamkeit und nahezu unerschütterliche Glaubenszuversicht und -sicherheit der Bibelforscher ließen sie bei der SS zu besonderen Hassobjekten werden, die sie und ihre außergewöhnliche Resistenz durch fortgesetzte Misshandlungen zu brechen versuchte. Dazu gehörten auch die zeitweilige Isolierung von anderen Häftlingen, die zeitweilige Einweisung in Strafkompagnien oder die Verhängung einer totalen Postsperre. Insbesondere bis Kriegsbeginn wütete die SS mit völlig enthemmter, sadistischer Gewalt gegen die Zeugen Jehovas und deren ausgeprägten, vom Glauben getragenen Selbstbehauptungswillen. Nicht wenige Zeugen Jehovas wurden dennoch systematisch zu Tode geschunden.
In den späteren Jahren verbesserte sich die Lage der Bibelforscher in den KZ, da sie wegen der stark anwachsenden Bedeutung der Häftlingsarbeit zu begehrten Kräften geworden waren, deren handwerkliche Versiertheit, Fleiß und Sorgfalt die SS zu nutzen wusste. Hinzu kam, dass sie aus Gründen des Glaubens eine Flucht aus dem Lager ablehnten und auch außerhalb der Lager an schwierig zu überwachenden Plätzen eingesetzt werden konnten. Trotzdem waren sie auch hier einem gnadenlosen Arbeitsterror ausgeliefert und wurden z. B. in den zerbombten Städten zu Aufräumarbeiten auch von Leichen gezwungen. Dies lässt sich auch an den hier zu findenden Biogrammen der Brüder Höveler ablesen, die über Jahre in SS-Baubrigaden eingesetzt wurden und schwerste Arbeiten leisten mussten.
Die besondere Stellung der Zeugen Jehovas im Lagersystem war die Basis für eine verstärkte Fortsetzung ihrer Aktivitäten wie das Feiern von Gottesdiensten und Missionsarbeiten, das Errichten von Netzwerken, Kurierdiensten oder heimliche „Bibel- und Wachtturm-Studien“. Etwa jeder vierte der Bibelforscher-Häftlinge kam in der Konzentrationslagerhaft ums Leben. Viele Überlebende, wie auch Eduard, Wilhelm und Emma Höveler kehrten nach langen Jahren der Haft schwer geschädigt zurück zu ihren Familien. Aussagen vor einem weltlichen Gericht, das ihre Peiniger wegen ihrer Verbrechen hätte verurteilen können, lehnten sie aus Gründen ihres Glaubens ab. In ihrem Verständnis mussten sich die Täter allein vor Gott verantworten.
Die Zeugen Jehovas fordern wohl als letzte Verfolgtengruppe ein Mahnmal, das an ihren Widerstand erinnert und die Opfer würdigt. Die Errichtung eines solchen Mahnmals für die im Nationalsozialismus ermordeten Zeugen Jehovas und auch die wissenschaftliche Erforschung der Verfolgungsgeschichte zur öffentlichen Anerkennung des Unrechts wurden am 9. Mai 2023 durch die Fraktionen der SPD, CDU/CSU, Bündnis 90/Die Grünen und der FDP beim Deutschen Bundestag beantragt. Eine Umsetzung erfolgte bislang nicht.
Kriterien zur Aufnahme in das Gedenkbuch
Auch der Onlineversion des Gedenkbuches waren zunächst die Aufnahmekriterien der Druckfassung zugrunde gelegt worden. Hier fanden sich diejenigen Verfolgten, die in Detmold geboren wurden oder hier über längere Zeit oder nur zeitweise gelebt haben und die durch Gewaltmaßnahmen der NS-Diktatur ums Leben gekommen sind. Unberücksichtigt blieben damit die Überlebenden des NS-Terrorregimes. Menschen, die unter unwürdigsten Umständen überlebten, deren Lebensentwürfe zerstört wurden, die schwerste Schädigungen an Körper und Seele erfahren hatten und ihr Leben lang darunter litten und die schwer traumatisiert waren - und weiterlebten. Wenn diese Menschen nicht genannt, wenn ihre Biografien nicht dokumentiert würden, wären sie ein weiteres Mal vergessen, dann würden sie ein zweites Mal dafür bestraft, weil sie überlebt haben. Damit trägt nun endlich auch das Detmolder Gedenkbuch dem nicht nur in der Geschichtswissenschaft schon lange vertretenen Opferbegriff Rechnung.
Zu den einzelnen Biographien
Im Gegensatz zur ersten Fassung des Detmolder Gedenkbuches werden hier nun die Betroffenen nicht mehr im Familienverbund aufgeführt und dargestellt, sondern als einzelnes Individuum mit seinem jeweiligen eigenen Schicksal. Damit folgt die Onlinefassung auch der Darstellung der Gedenktafel für die Opfer der Gewaltherrschaft in Detmold, auf der die Betroffenen ebenfalls als Einzelpersonen in alphabetischer Reihenfolge zu finden sind.
Das Gedenkbuch bietet – sofern bekannt – folgende Informationen zu den betroffenen Personen:
- Name: Familienname, Vorname und ggf. Geburtsname
- Geburtsdatum und -ort
- Todesdatum und –ort
- Religionszugehörigkeit
- Angehörige ggf. mit persönlichen Daten
- Beruf
- Wohnorte (vorrangig nach Angaben der Einwohnermeldeämter des jeweiligen Wohnortes; zu den einzelnen Häusern und deren Geschichte s. www.lippe-haeuser-wiki.de)
- Darstellung des Schicksals, je nach Quellenlage
- Dokumente, Fotos, Briefe
- bibliographische Angaben der ausgewerteten Quellen
- Hinweise auf weitere Quellen und Informationen
- Literatur
Durch die zusammengestellten Informationen und Dokumente wird die radikal bürokratisierte, faktische Ebene von Lebenswegen belegt, verdeutlicht und dokumentiert. Dimension und Ausmaß des verwaltungstechnischen Aktes einer Inhaftierung werden im Detmolder Gedenkbuch insbesondere durch die vergleichsweise gut überlieferten Unterlagen – von der Registrierung des Eingelieferten, über die Aufstellung der Kleidung und der geringen Habe auf der Effektenkarte bis zur Todesmeldung des Häftlings – aus dem Konzentrationslager Buchenwald offensichtlich. Anders stellt sich die Quellenlage hingegen für das Konzentrationslager Sachsenhausen dar, denn dort wurden von der SS im Frühjahr 1945 noch vor der Befreiung des Konzentrationslagers alle Akten der Kommandantur einschließlich der Häftlingskartei und nahezu aller Häftlingsakten vernichtet. Die wenigen, nur unvollständig erhalten gebliebenen Akten befinden sich in verschiedenen Archiven, größtenteils in Archiven der Russischen Föderation.
Einen weiteren Schwerpunkt bilden Dokumente, die den Bemühungen der Nachfahren von Opfern um Entschädigungsleistungen nach dem Bundesentschädigungsgesetz (BEG) entstammen. Ausgewählte Unterlagen verdeutlichen die teils sehr langwierigen Bemühungen der Nachkommen, Leistungen im Rahmen der sog. Wiedergutmachung zu erwirken. Das teils unwürdige und beschämende Prozedere um die Anerkennung einer Berechtigung auf Entschädigungsleistungen kann durch diese Ausschnitte sicherlich nur ansatzweise dokumentiert werden. Die Nachfahren sahen sich aufgefordert, den oftmals schwierigen Nachweis für Inhaftierung und Tod ihrer Angehörigen zu führen, wobei sie vor allem die Dienste des Internationalen Roten Kreuz und des Sonderstandesamtes Arolsen nutzten, die ihnen Inhaftierungsbescheinigungen und Sterbeurkunden übermitteln konnten und damit den Leidensweg dokumentierten. Auch diese Unterlagen stellen eine wertvolle Quelle zur Aufklärung der Lebenswege von manchen Detmolder Opfern dar.
Doch auch die Fülle von Fakten und Daten, Dokumenten und Unterlagen, die dem Detmolder Gedenkbuch zugrunde liegen, führen trotz allem die Grenzen einer solchen Arbeit vor Augen: Das, was Schicksal oder Verfolgung heißt und was die Katastrophe in einem menschlichen Leben ausmacht, deren Wirkmächtigkeit bis in die Gegenwart reicht, kann nicht erfasst oder dargestellt werden. Es sind bislang 225 erforschte und hier dokumentierte menschliche Leben, die zerstört wurden.
„Die Welt ist seit dem Holocaust keine bessere geworden“, so die bittere Erkenntnis nicht nur von Elie Wiesel, der Auschwitz und Buchenwald überlebt hatte. Antisemitismus und Rassismus stellen die Welt tagtäglich vor große Herausforderungen.
Die gesellschaftspolitischen Folgen der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft dauern bis heute an und haben nichts an Aktualität eingebüßt, die die Zivilgesellschaft fordert und zu Haltung und entsprechendem Handeln verpflichtet.
1 Monika Minninger hingegen nennt den 26. April 1933 als Datum des Verbotes.
Dank
Für die Kooperation und Bereitstellung umfangreichen Datenmaterials danke ich vor allem den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Arolsen Archives, insbesondere Heike Müller und Andrea Hoffmann. Mein Dank gilt auch allen weiteren nationalen und internationalen Archiven und Gedenkstätten, natürlich auch hier vor Ort und in der Region.
Namentlich danke ich der Detmolder Stadtarchivarin Bärbel Sunderbrink für ihre freundliche, zugewandte und unkomplizierte Zusammenarbeit. Mein Dank gilt ebenso Yvonne Gottschlich vom Stadtarchiv Detmold, die die Übernahme der Einwohnermeldekarten der Stadt Detmold in das Gedenkbuch mit Kompetenz und beeindruckender Hilfsbereitschaft ermöglicht hat. Der ehemalige Detmolder Stadtarchivar Andreas Ruppert hat sich ebenso seit Jahren in den Dienst der Sache gestellt wie Lars Lüking vom Landesarchiv NRW Abt. Ostwestfalen-Lippe. Ihre fundierten Sachkenntnisse sind Teil der Detmolder Erinnerungskultur geworden und sind ebenfalls maßgeblicher Bestandteil dieser Arbeit. Dafür danke ich beiden sehr.
Rüdiger Schleysing ist die nicht nur umsichtige und sorgfältige, sondern auch sehr engagierte digitale Umsetzung zu verdanken.
Volker Buchholz danke ich auch in diesem Projekt nicht nur sehr für die archivarische und technische Unterstützung, sondern für seine große und vor allem geduldige Hilfe in vielerlei Hinsicht.