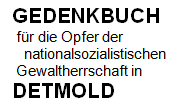„Abgemeldet in den Osten“
- Zum 80. Jahrestag der Deportation von jüdischen Menschen aus Detmold nach Riga am 13. Dezember 1941
 |
| Vom Bielefelder Hauptbahnhof wurden die Menschen am 13. Dezember 1941 nach Riga deportiert. (Quelle: Stadtarchiv Bielefeld) |
von Gudrun Mitschke-Buchholz
Als Detmolder Jüdinnen und Juden spätestens am 20. November 1941 von ihrer bevorstehenden „Umsiedlung“ durch ein Rundschreiben der Reichsvereinigung der Juden, Bezirksstelle Bielefeld, in Kenntnis gesetzt wurden, glaubten viele von ihnen an einen Arbeitseinsatz im Osten. Denn in dem Deportationsbescheid fand sich eine detaillierte Auflistung des erlaubten Gepäcks von 50 kg, in dem neben Koffer, Bettzeug und Essgeschirr sowie Verpflegung für drei Tage auch die Mitnahme von Werkzeug gestattet war. Untersagt waren hingegen Wertsachen jeder Art und auch Messer und Rasierzeug, um Gegenwehr und Freitode zu verhindern.
Die Reichsvereinigung hatte zwangsweise die Vorgaben für Lippe an ihr Detmolder Büro, das von Eduard Kauders und Moritz Herzberg geleitet wurde, weitergegeben. Beide Männer waren bereits in Buchenwald in Haft gewesen, und so ist davon auszugehen, dass sie mit ihren dortigen Erfahrungen nur schwer an eine reine Evakuierungsaktion glauben konnten. In panischer Hektik stellten die Betroffenen alles an Materialien zusammen, von dem sie meinten, es in einem wie immer gearteten Arbeitsalltag gebrauchen zu können. Auch die für Ende November noch angesetzten Impftermine verstärkten den Anschein einer Umsiedlung.
Das Detmolder Büro der Reichsvereinigung sorgte „auf eigene Kosten“ für einen LKW, der die Jüdinnen und Juden am 10. Dezember 1941 nach Bielefeld brachte, wo sie drei Tage lang in katastrophalen Umstände im früheren Saal der Gastwirtschaft „Kyffäuser“ am Kesselbrink auf Stroh ausharren mussten. Dort wurden ihnen letzte Wertgegenstände wie Eheringe und auch die Pässe abgenommen. Die Vergabe von Nummern führte den Betroffenen das Ziel dieser Maßnahme vor Augen: „Jetzt sind wir nichts mehr… jetzt existieren wir nicht mehr,“ schilderte 1993 Edith Brandon, geb. Blau aus Minden in einem der wenigen Interviews von Riga-Überlebenden diese Situation. Am 13. Dezember 1941 wurden die Menschen mit Autobussen zunächst zum Bielefelder Hauptbahnhof geschafft und von dort in Personenwagen dritter Klasse nach Riga transportiert. Für die Fahrtkosten mussten sie selbst aufkommen. Die mehr als 1.000 Jüdinnen und Juden des Transportes kamen aus über einhundert Orten im Einzugsbereich der Gestapoleitstelle Münster. Aus diesem Transport sind nur 102 Überlebende bekannt. Manche überstanden den Transport, auf dem ihnen alsbald das Wasser entzogen wurden, nicht.
Als der Zug am 15. Dezember 1941 in eisiger Kälte an der Rampe der Frachtgutstation Skirotava in Riga ankam, mussten die Deportierten im verschlossenen Zug noch einen Tag ausharren, bis sie mit Peitschenhieben von SS-Leuten aus dem Zug getrieben wurden. Ihr mühselig zusammengestelltes Gepäck sahen sie nicht wieder. Den langen Fußmarsch durch tiefen Schnee zum Rigaer Ghetto überlebten wiederum manche nicht: Kranke und Alte wurden erschossen. Misshandlungen waren allgegenwärtig. Im Ghetto selbst lag das, was als „letzte Habseligkeiten“ bezeichnet wird, neben vereisten Blutlachen im Schnee. Die völlig erschöpfen und schockierten Menschen wurden in den heruntergekommenen Häusern eingewiesen. Die Straßen waren nach dem jeweiligen Ausgangspunkt der Deportation benannt war, und so wurden auch die Detmolder Deportierten in der Bielefelder Straße in großer Enge untergebracht. Dort fanden sie zum Teil noch das gefrorene Essen der lettischen Juden vor, die wenige Tage zuvor ermordet worden waren: „Die sind weg – für uns… Wenn kein Platz mehr ist, werden wir so abgemetzelt“, so wiederum Edith Brandon in ihrem Bericht. Dennoch mussten sich die Menschen in dieser gegenmenschlichen Situation mit diesem Wissen einrichten: „Dann hat man überlebt … um zu überleben“ hieß Edith Brandons bittere Bilanz.
Für viele Deportierte bedeutete das Ghetto in Riga das Ende. Für andere war es nur eine Station ihres Leidensweges. Als das Ghetto 1944 aufgelöst wurde, wurden die letzten Überlebenden in Konzentrations- und Vernichtungslager verschleppt. Edith Brandon wurde mit ihrer Mutter nach Stutthof geschafft. Diese erste Deportation aus Lippe jährt sich in diesem Jahr zum 80. Mal. An die mehr als dreißig Betroffenen, die mit Detmold in Verbindung standen, wird im Detmolder Gedenkbuch gedacht. Keiner von ihnen überlebte.
Am 10. September 2020 fasste der Rat Stadt Detmold einstimmig den Beschluss dem Deutschen Riga-Komitee beizutreten, das im Jahr 2000 u.a. vom Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge gegründet wurde. Diesem erinnerungskulturellen Städtebund gehören 64 Städte aus ganz Deutschland an.
Das vollständige Interview, das Joachim Meynert mit Edith Brandon führte, wird im LAV NRW Abt. OWL verwahrt. Einen Ausschnitt sowohl als Hörfassung als auch in Textform findet sich in „Die letzten Augenzeugen zu hören…“ von Joachim Meynert und Gudrun Mitschke. Bielefeld 1998. Edith Brandons hinterlassene Dokumente sind im United States Holocaust Memorial Museum auch digital einsehbar.
Detmold, im Dezember 2021
„Reisen Freitag ab nach Theresienstadt in Böhmen“
- Zum 80. Jahrestag der Deportation von Detmolder Jüdinnen und Juden nach Theresienstadt am 31. Juli 1942
von Gudrun Mitschke-Buchholz
%20(Stadtarchiv%20Detmold)).jpg) |
| Foto 1: Frieda Kauders, Irma Buchholz, Eduard Kauders, Gerhart, Ilse und Bernhard Buchholz (v. l. n. r.) (Stadtarchiv Detmold) |
.jpg) |
| Foto 2: Moritz Herzberg, ca. 1938 (Sammlung Joanne Herzberg) |
.jpg) |
| Foto 3: Die letzte Nachricht der Familie Herzberg vor ihrer Deportation nach Theresienstadt, Sammlung Joanne Herzberg) |
.jpg) |
| Foto 4: Arthur Buchholz, o. J. (Stadtarchiv Detmold DT V 19 Nr. 175) |
.jpg) |
| Foto 5: Emilie Frank, o. J (Sammlung Joanne Herzberg) |
.jpg) |
| Foto 6: Ludwig Frenkel, o. J. Stadtarchiv Detmold DT V 19 Nr. 176) |
Mit einem Schreiben der Bezirksstelle Westfalen der Reichsvereinigung der Juden in Deutschland vom 19. Juli 1942 wurden die „Teilnehmer des Abwanderungstransports vom 31. Juli nach Theresienstadt“ über ihre „Umsiedlung“ informiert. Darin hieß es „Die Bedingungen sind sehr grosszügig gehalten und es dürfte bei rechtzeitiger und praktischer Auswahl möglich sein, für jede Familie das Notwendigste zur Errichtung eines bescheidenen Haushaltes mitzunehmen.“ Es folgte eine Aufstellung von Gegenständen (u. a. Federkissen, Essgeschirr, Sommer- und Winterkleidung, Nähmaschinen, Werkzeuge) samt Familienandenken und Fotos, die den Betroffenen erlaubt waren.
Dieser Deportationsbescheid bedeutete für fast alle Detmolder Jüdinnen und Juden das Ende. Nach Jahren der Ausgrenzung, der systematischen Verarmung, in die Isolation getrieben und in beständiger Angst lebend saßen auch die Mitglieder der Detmolder Gemeinde seit dem Ausreiseverbot vom Oktober 1941 in der Falle. Sie hatten miterlebt, dass ihre Angehörigen, Nachbarn, Freunde und Bekannte auf die Transporte „in den Osten“, nach Riga und nach Warschau gezwungen worden waren. Es war nur noch eine Frage der Zeit, wann die nächsten den gefürchteten Bescheid erhielten.
Aus der Öffentlichkeit und damit auch aus der Wahrnehmung waren die jüdischen Nachbarn weitestgehend verdrängt, während für den Großteil der Bevölkerung der bestehende und gewohnte Alltag auch weiterhin in vielen Bereichen funktionierte und „das Leben weiterging“. Unter dem Druck des Krieges hatte sich der moralische Horizont der Menschen nach ohnehin jahrelanger Propaganda jedoch nochmals verengt. Fast alle konzentrierten sich auf den engen Kreis der eigenen Angehörigen und auf die Organisation des Alltags. Wo waren die Nachbarn geblieben? Wann und wohin sind sie „gegangen“? Irgendwann, so sollte es später heißen, waren “die Juden weg“.
In die Vorbereitungen der Deportationen waren Eduard Kauders (Foto 1) und Moritz Herzberg (Foto 2) als Leiter des Detmolder Büros der Reichsvereinigung organisatorisch direkt miteinbezogen. Sie erhielten die Direktiven der Bielefelder Bezirksstelle , die von der Gestapo gezwungen wurde, an den Deportationen mitzuwirken.
Im Deutschen Reich und auch im Protektorat wurden die jeweiligen jüdischen Gemeindebüros vom Datum der bevorstehenden Deportationen aus ihrem Gebiet verständigt. Die örtliche Gestapostelle erhielt vom Bezirksbüro der Reichsvereinigung die Namenlisten und entschied dann, wer auf den Transport geschickt wurde. Die jeweilige jüdische Gemeinde hatte den Betroffenen ein Rundschreiben mit genauen Anweisungen über Zeitpunkt der Deportation, zum ordnungsgemäßen Verlassen der Wohnungen, zur Abgabe von Wertgegenständen und eine detaillierte Aufstellung des mitzunehmenden Gepäcks zuzustellen. Von diesem Zeitpunkt an war es den Menschen untersagt, ohne Genehmigung der Behörden ihre Wohnung – auch nur für einen kurzen Zeitraum – zu verlassen.
Eduard Kauders und Moritz Herzberg hatten die Transporte ihrer Freunde, Nachbarn und Gemeindemitglieder nach Riga und Warschau organisatorisch begleiten müssen. Als die Deportationen nach Theresienstadt begann, standen auch sie mit ihren Angehörigen auf der Liste. Moritz Herzberg und seine Familie schickten noch drei Tage vor ihrer Abreise über das Rote Kreuz die in der Überschrift zitierten dürren Nachrichten an ihren Sohn Fritz nach Afrika. (Foto 3) Ein Abschied in den 25 erlaubten Worten. „Wir schreiben sobald als möglich. Herzlichst wir Vier.“ Sie schrieben nicht mehr. Dies war ihr letztes Lebenszeichen.
Für die Deportation nach Theresienstadt mussten sich die Menschen am 28. Juli 1942 auf dem Detmolder Marktplatz einfinden, und damit an zentraler Stelle der Stadt, um zum Abtransport in Richtung Bielefeld auf Lastkraftwagen verladen zu werden. Einer Zeugenaussage aus dem Jahre 1947 zufolge, die sich vermutlich auf diese Deportation bezog, habe die
der Verladung der Menschen beiwohnende Pfarrerswitwe Meta Ulmke geschrien: „Diesen Itzigs sollte man erst den Bauch aufschneiden und
[sie] dann wegbringen!“ Am 31. Juli 1942 verließ der Transport den Bielefelder Güterbahnhof nach Theresienstadt.
Theresienstadt wurde in der NS-Propaganda als sogenanntes Alters- und Vorzugsghetto für Juden über 65 Jahre und für diejenigen mit Kriegsauszeichnungen auf zynische Weise verklärt und als angebliche „jüdische Mustersiedlung“ ausländischen Delegationen vorgeführt. Diesen Juden wurden sog. Heimeinkaufsverträge angeboten, in denen ihnen bis zu ihrem Lebensende angemessene Unterbringung, Verpflegung und ärztliche Versorgung zugesichert wurden. Die harte Realität des Ghettos traf insbesondere die hochbetagten Menschen. Viele von ihnen überstanden Hunger, Krankheiten und die Leiden des Lagerlebens nicht lange.
Vom Detmolder Transport waren auch die Bewohner und Bewohnerinnen
des jüdischen Altersheims in der Gartenstraße 6 betroffen. Zu ihnen gehörte Rebekka Berger. Sie starb in Theresienstadt nach kurzer Zeit im Oktober 1942 im Alter von 84 Jahren. Johanna Levy überlebte 89-jährig dort nur zwei Wochen. Sophie Plaut und Bertha Obermeier starben im Alter von 86 Jahren ebenfalls nach kurzer Zeit. Im Herbst 1942 waren etwa 50% der Inhaftierten über 65 Jahre alt. Als kurze Zeit später alte Menschen direkt in die Vernichtungslager deportiert wurden, sank dieser Prozentsatz. Insofern umfasste der Zeitraum, in dem man Theresienstadt als „Altersghetto“ bezeichnen konnte, nur ein halbes Jahr.
Arthur Buchholz, der bereits schwerkrank ins Ghetto getragen werden musste, wurde dort noch unter entsprechenden Bedingungen operiert. (Foto 4) Er überlebte den Eingriff um zwei Wochen. Emilie Frank, die Schwiegermutter von Moritz Herzberg, wurde in ihrem 92. Jahr in Theresienstadt um ihr Leben gebracht. (Foto 5) Einige erhalten gebliebene „Todesfallerklärungen“ des dortigen Ältestenrates geben eine unsichere Auskunft über die Todesursachen.
Nachrichten über Massendeportationen und erste Nachrichten über Vernichtungen riefen die Aufmerksamkeit der internationalen Öffentlichkeit hervor, die durch propagandistische Täuschungen wie den Propagandafilm „Theresienstadt. Ein Dokumentarfilm aus dem jüdischen Siedlungsgebiet“ oder durch eine großangelegte „Stadtverschönerungsaktion“ im Jahr 1943 beruhigt werden sollte. Vor allem kranke Häftlinge oder diejenigen, die wegen ihres Aussehens nicht dafür taugten, einer ausländischen
Delegation vorgeführt zu werden, wurden nach Auschwitz deportiert. Im Rahmen der „Verschönerung“ Theresienstadts traf dies im Dezember des Jahres 5000 Menschen.
Theresienstadt galt wegen zahlreicher Musiker, Schauspieler, bildender Künstler, die dort leben mussten, auch als „Künstlerghetto“, wo Opern unter schwierigsten Bedingungen zur Aufführung gebracht wurden. Auch andere musikalische Beiträge – sicher auch ein Element der Selbstbehauptung – mochten an eine Welt erinnern, die für die Ghettobewohner mehr als jenseits ihrer Lebensrealität war. Raphael Schächter, ein tschechischer Dirigent, studierte mit Ghettobewohnern
ohne Noten Verdis Requiem ein. Wenn Deportationen große Lücken rissen, wurden schnell andere Sänger gefunden. Als das Stück vor ihrer Deportation zum letzten Mal erklang, sangen sie die katholische Totenmesse für sich selbst. Kaum jemand der Beteiligten überlebte.
Zu Theresienstadt gehörte nicht nur die sog. Kleine Festung, in dem ein Gestapo-Gefängnis eingerichtet wurde. Berichte von Überlebenden zeugen von den Qualen der dort gefangenen Menschen. Theresienstadt zählte zudem neun Außenlager, sog. Außenkommandos. Und Theresienstadt
war ein Transitlager auf dem Weg in die Vernichtungslager. So wurde Rosa Levysohn, die noch eigens für Theresienstadt Möbel hatte anfertigen lassen, ebenso wie der 86-jährige Julius Beerens im September 1942 von dort in das Vernichtungslager Treblinka deportiert.
Ab dem 26. Oktober 1942 hatten die Transporte aus Theresienstadt „in
den Osten“ nur noch als einziges Ziel: Auschwitz II - Birkenau. In dieses Vernichtungslager ging die Hälfte der 63 Transporte, die aus Theresienstadt abfuhren. So erhielt das vermeintliche Vorzeigeghetto den Beinamen „Wartehalle für Auschwitz“. Auguste und Bernhardine Michaelis-Jena hatten im Detmolder Altersheim noch für die jüdischen Menschen gesorgt. Im Mai 1944 wurden sie aus Theresienstadt nach Auschwitz deportiert. Auch Frieda und Eduard Kauders wurden in diesem Jahr in das Vernichtungslager verschleppt. Ludwig Frenkel, der kleine Bruder von Karla Raveh und Schüler der jüdischen Schule in Detmold, wurde im Oktober 1944 aus Theresienstadt nach Auschwitz deportiert. Er wurde zehn Jahre alt. (Foto 6) Seine Eltern, seine Geschwister starben ebenfalls dort. Nur Karla überlebte.
Dass seine Frau Johanna und seine Tochter Gerda ebenfalls noch nach Auschwitz deportiert wurden, erlebte Moritz Herzberg nicht mehr. Er war einige Monate zuvor den Leiden der Haft erlegen.
Alle Genannten stehen stellvertretend für die Detmolder Opfer. Menschlichkeit, jene normative Qualität des Menschseins, hatte für sie schon lange nicht mehr gegolten. In ihrem Dasein hatte sich eine
Ideologie des Hasses erfüllt.
Emma und Minna Ries aus der Sachsenstraße überlebten Theresienstadt und kehrten nach ihrer Befreiung zurück nach Detmold. Dort trafen sie auf erstaunte Gesichter. Nachbarn, die mit ihrer Rückkehr nicht gerechnet hatten. Gewartet hatte niemand auf sie.
Detmold, im Juli 2022
Detmold – die Stadt der drei Synagogen
 |
| Ehemaliges Bethaus, Bruchmauerstraße 37 im Jahr 2020. (Foto: Volker Buchholz) |
Ein Beitrag zum Festjahr 2021 – 1700 JAHRE JÜDISCHES LEBEN IN DEUTSCHLAND
von Gudrun Mitschke-Buchholz
In diesem Jahr wird die lange Geschichte jüdischen Lebens in Deutschland als wichtiger Bestandteil der europäischen Kultur durch ein Festjahr gewürdigt. Seit 1700 Jahren leben Jüdinnen und Juden auf dem Gebiet des heutigen Deutschlands. Das erste schriftliche Zeugnis jüdischer Kultur stammt aus dem Jahr 321 und damit bereits aus der Zeit der Spätantike. Unter dem Namen #2021JLID – Jüdisches Leben in Deutschland werden bundesweit rund tausend Veranstaltungen wie Konzerte, Ausstellungen, Musik, Podcast, Theater und Filme ausgerichtet. Ziel dieses Festjahres ist laut der Initiatoren, jüdisches Leben sichtbar und erlebbar zu machen und dem erstarkenden Antisemitismus entgegenzutreten.
Auch in Detmold lassen sich noch Spuren und Zeugnisse der weitestgehend zerstörten jüdischen Lebenswelt finden. Bemerkenswerterweise fanden sich in der Kleinstadt Detmold neben einem privaten Betraum drei jüdische Gotteshäuser, von denen heute noch zwei erhalten sind. An die im Jahr 1907 eingeweihte und während der Ausschreitungen des Novemberpogroms 1938 zerstörte Neue Synagoge erinnert nur noch eine Gedenktafel in der Lortzingstraße. Die erhaltene Alte Synagoge, Exterstraße 8, dient heute einer Freikirche als Gotteshaus. Das benachbarte „Vorsängerhaus“ zur Externstraße dokumentiert seine wechselvolle Geschichte durch seine hebräische Inschrift.
Lange Zeit unbeachtet war hingegen das Bethaus in der Bruchmauerstraße 37. Das unscheinbare und bereits deutlich vom Verfall gezeichnete Gebäude war lange vergessen und in seiner bau- und auch stadtgeschichtlichen Bedeutung vollkommen unterschätzt und verkannt. Was noch 1988 als Gartenhaus in die Denkmalliste der Stadt Detmold aufgenommen wurde, ist eine freistehende Hofsynagoge. Dies konnte durch die Forschungen der LWL-Denkmalpflege und durch die Auswertung archivalischer Quellen im Stadtarchiv Detmold und Landesarchiv NRW nachgewiesen werden. Dieses Bethaus gilt demnach als frühester Beleg für den Typ einer freistehenden Synagoge in Nordwestdeutschland. Durch dendrochronologische Untersuchungen der verbauten Hölzer konnte die Errichtung des Kerngerüstes auf 1633 datiert werden und damit weitaus früher als bis dahin angenommen. Das Gebäude wurde somit zu einem Zeitpunkt errichtet, als sich einige jüdische Familien nach der Vertreibung der Juden im Jahre 1614 aus der Grafschaft Lippe wieder in Detmold niedergelassen hatten und auch wieder Gottesdienste abhalten wollten.
Wie für frühneuzeitliche Synagogen charakteristisch, liegt des Detmolder Bethauses etwas versteckt im Hof hinter dem ehemaligen Spangenbergschen Haus, Krumme Straße 28. Es weist eine nur sehr kleine Grundfläche von 34,5 m² auf und war, den religiösen Vorschriften gemäß, nach Osten ausgerichtet. An der Ostwand befand sich eine Vorrichtung für die Aufbewahrung der Thorarollen. Die religiösen Regeln besagen ebenso, dass aus der Richtung Jerusalems Tageslicht einfallen muss, und auch dies war hier durch eine entsprechende Fensteröffnung gegeben. Der Betsaal war im Erdgeschoss und umfasste die gesamte Grundfläche des Hauses. Der Standort der Bima, also des Vorlesepultes, befand sich vor dem Thoraschrein im Mittelteil des Betraumes. Rekonstruieren ließ sich zudem eine Frauenempore mit zwei hintereinander stehenden Bänken für jeweils fünf bis sechs Frauen.
Die Judenschaft hatte nachweislich 1723 das Gebäude vom Stadtmusikanten Julius Hardewig Spangenberg nur angemietet. Das war nicht ungewöhnlich, da es Juden bis in das 18. Jahrhundert nicht erlaubt war, Immobilien zu besitzen. Möglicherweise bedingt durch die räumliche Enge und auch durch die ungesicherten Mietverhältnisse, schuf sich 1742 die Detmolder jüdische Gemeinde durch den Umbau einer Scheune eine neue Synagoge in der Exterstraße 8 (Alte Synagoge), die zu kaufen ihnen durch Genehmigung vom Stadtrat und vom Landesherrn Simon August erlaubt war.Dem 2010 durch den Eigentümer des nur vermeintlichen Gartenhauses gestellten Antrag auf Abbruch zugunsten der Errichtung von Parkplätzen wurde aufgrund der Forschungen nicht stattgegeben.
Der Denkmalwert des auch überregional bedeutsamen Bethauses wurde durch die Behörden eindeutig begründet. Zwingend notwendige weitere wissenschaftliche Untersuchungen könnten die Erkenntnisse zu dem Bethaus in Detmold weiter vertiefen. Es gilt weiterhin, dieses Kleinod mit großer historischer Bedeutung vor dem endgültigen Verfall zu retten.
Weitere Informationen finden sich in:
Fred Kaspar und Peter Barthold: Ein Gebäude macht Geschichte. Das vergessene jüdische Bethaus von 1633 in Detmold, Bruchmauerstraße 37. In: Lippische Mitteilungen aus Geschichte und Landeskunde, 86 (2017), S. 155-172
sowie in
Gudrun Mitschke-Buchholz: Auf jüdischen Spuren. Ein Stadtrundgang durch Detmold. 3. Aufl. – Lage 2020, S. 47-49. Hier findet sich nicht nur ein Kapitel zum Bethaus, sondern Informationen zu mehr als zwanzig weiteren Orten jüdischer Tradition und Kultur in Detmold. Diese Orte werden in den öffentlichen Stadtführungen „Auf jüdischen Spuren“ mit Gudrun Mitschke-Buchholz zwischen Mai und Oktober gezeigt.
Auf jüdischen Spuren
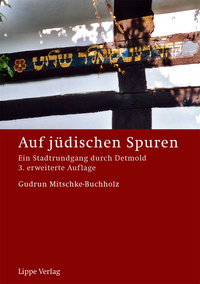 |
Ein Stadtrundgang durch Detmold
von Gudrun Mitschke-Buchholz
Panu Derech - Beiträge zur jüdischen Regionalgeschichte, Schriftenreihe der GCJZ Lippe, Bd. 21
Detmold 2020, 3. überarbeitete Auflage Auflage, 100 Seiten, ISBN 978-3-89918-080-0, 12,90 Euro
Über Jahrhunderte haben Jüdinnen und Juden das Leben und auch den Wandel der Stadt Detmold mitgeprägt und gestaltet. Wer sich heute auf jüdische Spuren begibt, hat jedoch Mühe, die steinernen Zeugnisse zu finden, die das reiche Kulturerbe vor Augen führen und dokumentieren könnten, denn der größte Teil dieser Lebenswelt wurde zerstört oder deren Spuren verwischt.
In dem nun erschienen Stadtrundgang, der auch durch das Stadtarchiv Detmold unterstützt wurde, werden Stätten der religiösen Kultur, Wohn- und Geschäftshäuser aus ehemals jüdischem Besitz und auch Spuren der Entrechtung und Ghettoisierung der jüdischen Bevölkerung gezeigt. Ebenso wird auf die Detmolder NS-Institutionen verwiesen, die für Ausgrenzung, Verfolgung und Deportation der jüdischen Menschen verantwortlich waren. Eine beiliegende Karte erleichtert auch Ortsfremden die Orientierung. Das Buch liegt in einer dritten, vollständig überarbeiteten und erweiterten Auflage vor.
Der Band ist beim Verlag, bei der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit in Lippe e. V., in den örtlichen Buchhandlungen und in der Tourist-Information der Stadt Detmold erhältlich.
Einweihung der Gedenktafel für Joseph Plaut am Detmolder Landestheater am 11. April 2023
Rede von Gudrun Mitschke-Buchholz
Vielleicht kennen Sie das: Auf einer Reise im In- oder auch im Ausland wird man gefragt, wo man denn herkomme. Es kann passieren, dass dann völlig fremde Menschen anfangen zu singen oder zumindest den Text aufzusagen: „Lippe Detmold, eine wunderschöne Stadt“. Auch mit der etwas verrutschten Betonung von wunderschön. Wer aber wusste oder weiß, dass Joseph Plaut aus Detmold, der Wunderschönen, wohl der bekannteste, erfolgreichste und zugleich am stärksten angefeindete Interpret der sogenannten Detmold-Hymne war?
Meistens ist über Joseph Plaut Anekdotisches zu hören, heitere Geschichten und Schmonzes. Die Familie Plaut ist heute fester Bestandteil der Detmolder Erinnerungskultur und auch die nun eingeweihte Gedenktafel bildet hierzu einen weiteren Mosaikstein. Auf dem hiesigen Friedhof finden wir für zwei bzw. drei Familienmitglieder ihre Gräber. Für Siegfried Plaut, Josephs Bruder, gibt es, wie es dann so heißt, nur „ein Grab in den Lüften“.
Joseph Plaut war Jude. Für ihn selbst spielte dies keine große Rolle, wie für so viele jüdische Detmolder Bürgerinnen und Bürger, die sich vor allem als deutsche Staatsbürger manchmal mit dem Zusatz ‚jüdischen Glaubens‘ verstanden. Von Kurt Tucholsky stammt die Verballhornung „deutscher Staatsjude bürgerlichen Glaubens“ und wahrscheinlich gefiel diese Formulierung auch Joseph Plaut, der Sinn für derlei Humor hatte, und sich selbst bisweilen als „schwarzes Schaf unter den sieben Kindern eines Rabbiners“ bezeichnete. Sein Vater Abraham war als Lehrer und Schulinspektor dem jüdischen Glauben ebenso verbunden wie sein Bruder Siegfried, der ebenfalls als Lehrer an jüdischen Einrichtungen tätig war.
Joseph Plaut hingegen wählte zunächst den Beruf des Kaufmanns und diente als Einjährig-Freiwilliger in der Preußischen Armee, und auch im Ersten Weltkrieg war er Soldat. Noch war eine jüdische Herkunft kein Grund zum Ausschluss. Bereits bei seinen ersten Kriegsdiensten stellte Plaut als Truppenunterhalter sein komisches Talent unter Beweis. Hier wird aber auch ein Prinzip deutlich, das sich nachhaltig durch sein Leben ziehen sollte: Joseph Plaut war auch angesichts dramatischer Zeitläufte zu einer Distanzierung vom Geschehen durch Komik, Parodien, Plaudereien und launige Antworten in der Lage.
Plaut nahm ein Gesangsstudium in Berlin auf; seine Karriere als Opernsänger begann 1902, wobei ihm die Rolle des Buffo auf den Leib geschrieben schien. Zunächst arbeitete er an kleinen Häusern in kleinen Städten, später – bis 1914 – am Deutschen Opernhaus und am Hebbeltheater in Berlin, jener Stadt, die zumindest eine Zeitlang sein Zuhause werden sollte.
Aber Joseph Plaut war nicht nur Sänger, sondern reüssierte als Schauspieler und vor allem als Vortragskünstler. Reichsweit wurde er bekannt mit munteren Plaudereien und Programmen, die er zum Teil mit seiner nichtjüdischen Frau Maria Schneider einem begeisterten Publikum präsentierte. Seine vom Elternhaus befürchtete Entscheidung für eine brotlose Kunst brachte ihm das Gegenteil ein: Erfolg, Wohlstand, Rampenlicht und ein Leben auf der Bühne. Aber auch der Rundfunk und Schallplatten waren entscheidende Medien für Plaut und erweiterten erheblich seinen Radius.
Im Repertoire des berühmten Vortragskünstlers fand sich das weit über Lippe hinaus bekannte Spottlied auf den „Lippischen Schützen“. Plaut (selbst Lipper) machte sich in seinem Programm in seiner typischen Distanzierung über die Lipper lustig, lachte über das Militär und veralberte die Lipper im Krieg. Doch was ihm lange nachgesehen wurde und worüber zumindest manche Lipper selbstironisch lachen konnten, geriet in den Zeiten des immer öfter unverhohlen und verschärft demonstrierten Antisemitismus der Weimarer Republik ins Visier der erstarkenden Nationalsozialisten. Aus dem Vortragskünstler Plaut wurde der „Jude Plaut“, der 1935 im Sinne der Nürnberger Rassegesetze zum sogenannten Volljuden erklärt werden sollte. Dass ausgerechnet „der Jude“ diese lippische, deutsche Hymne vortrug, wurde zum politischen Skandal. Vor allem die nationalsozialistischen Kräfte fühlten sich verhöhnt und verunglimpft. Für sie war es nicht auszudenken, dass in einer deutschen Kulturstätte, die in ihrem Verständnis nur deutschen („arischen“) Kulturschaffenden vorbehalten sein sollte, ausgerechnet ein jüdischer Künstler die Lipper in den vermeintlichen Dreck zog.
Im Januar 1932 war die NSDAP mit knapp einem Drittel der Wählerstimmen in die Detmolder Stadtverordnetenversammlung eingezogen. Drei Monate später sorgten zwanzig Nationalsozialisten bei einem Auftritt Plauts hier im Theater für die Demonstration des neuen Tons „der neuen Zeit“. Sie pöbelten, grölten das Horst-Wessel-Lied und warfen Stinkbomben. Völlig unverhohlen, dreist, widerwärtig machten sie sehr deutlich, was ihren Gegnern künftig – mindestens – entgegenschlug. Es war ein antisemitischer Übergriff im öffentlichen Raum, auf offener Bühne im April 1932 – und damit ein Dreivierteljahr vor der Machtübernahme durch Adolf Hitler. Es waren nicht nur einzelne, die man als ungefährliche, verirrte Randalierer hätte abtun können. Als diese polizeilich aufgefordert wurden, das Theater zu verlassen, forderten manche von ihnen das Eintrittsgeld zurück.
Die Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung zeigten sich angesichts der Tat entsetzt. Trotzdem fand ein Antrag, Plaut aufzufordern, die Lieder „Lippe Detmold“ und den „Lippischen Schützen“ aus seinem Programm zu streichen, eine Mehrheit, da er sie verächtlich machend vortrage. Der sogenannte Theaterskandal, an den nun diese Gedenktafel mahnend erinnert, ging durch die Zeitungen und verursachte eine Presseschlacht - und endete mit einem Strafverfahren. Noch funktionierte die lippische Justiz. Die Täter, unter ihnen z. B. Fritz Grüttemeyer, der durch seine Tatbeteiligung am Mord an Felix Fechenbach bekannt ist, wurden zu einer Geldstrafe verurteilt.
Der NS-Staat entledigte sich bald der jüdischen Kulturschaffenden. Der einst gefeierte Künstler Plaut erhielt Berufsverbot und wurde in der Folge des sogenannten Dritten Reiches aus der Reichsmusikkammer ausgeschlossen. Hier in der Stadt und auch im Theater manifestierte sich die „Machteroberung“ im öffentlichen und auch kulturellen Leben. Ab 1935 fanden hier im Hause die Wagner-Festwochen statt, die Detmold zum „Vorort Bayreuths“ machen sollten. Offiziell als „reichswichtig“ deklariert, waren diese Festwochen Großereignisse, wie sie die Stadt bis dahin nicht erlebt hatte. Die Einbeziehung von Gauleitung und Partei zahlte sich in den Folgejahren für die „Festwochen“ auch finanziell aus. Gastengagements renommierter Künstlerinnen und Künstler waren ebenso möglich wie die Vergrößerung des Orchestergrabens, da das Theater für Wagner eigentlich zu klein war.
Doch zurück zu Joseph Plaut: Wer konnte, verließ dieses Land. Joseph Plaut und auch seine hoch betagte Mutter und sein Bruder Manfred wurden 1936 ins Exil getrieben. Auch seine Schwester Ella flüchtete, nachdem sie als Mitarbeiterin der Post zwangsweise in den Ruhestand versetzt worden. Allein Siegfried und dessen Frau blieben. Zum Glück hatten die Plauts mit den Schwestern Mali (seit 1923 in Afrika) und Toni, die bereits einige Jahre in Südafrika lebten, einen Anlaufpunkt, einen Ort, an dem sie überleben konnten – und dies in vergleichsweise guten Bedingungen. Diese erlaubte ihnen auch, andere lippische jüdische Flüchtlinge zu unterstützen. Doch was macht ein Künstler, der allenfalls rudimentär Englisch sprach und so sehr mit der deutschen Sprache und der deutschen, lippischen Mentalität verbunden war? Plauts Plaudereien und Lieder „funktionieren“ nicht in englischer Übersetzung weitab der vermeintlichen Heimat, im Ausland. Einige wenige Engagements waren nicht genug, und so verließ Joseph Plaut sein erstes Exil und ging 1937 nach England. Trotz aller massiver Probleme für die Flüchtlinge, die niemand wollte und schon gar nicht auf dem Arbeitsmarkt, gelang es Plaut, zumindest in Ansätzen, als Künstler und Lehrer zu arbeiten. Doch zehn Monate wurde er als „Feindlicher Ausländer“ auf der Isle of Men interniert. Und trotz aller Schwierigkeiten gelang es Plaut später, dank seines starken Willens und seiner Durchsetzungskraft für die BBC zu arbeiten. Trotz allem launige Briefe an die Familie in Afrika sind ein weiteres beredtes Zeugnis seines Naturells.
Joseph Plauts Sehnsucht gehörte Deutschland. Er wollte so bald wie möglich zurück und tat dies auch, als das Tausendjährige Reich ein Ende hatte. 1949 kehrte er nach Deutschland und später auch in seine Heimatstadt zurück. Vor allem seine Schwester Ella machte deutlich, dass sie diese Rückkehr kein Verständnis hatte. Auf wen traf Plaut hier und welche Lücken hatten Verfolgung und Gegenmenschlichkeit gerissen? Welche Verluste hatten auch ihn getroffen? Sein Bruder Siegfried und auch seine Schwägerin Martha waren 1942 in Theresienstadt um ihr Leben gebracht worden.
Plaut fädelte sich wieder ein in das „neue“ deutsche, entnazifizierte Kulturleben. Auch hier im Landestheater konnte er anknüpfen. Er traf wiederum auf Otto Will-Rasing, Parteimitglied seit 1939 und Kulturreferent der SA, der von 1934 bis 1944 hier am Hause systemkonform Intendant war. Dessen NS-Vergangenheit stand offenbar nicht zwischen ihnen.
Joseph Plaut wurde immer wieder in seiner Nachkriegskarriere von Journalisten gefragt, wie er mit seiner eigenen Verfolgung, der gebrochenen, versehrten Familienbiografie, dem Exil und den Verlusten umgehe. Aus unserer Perspektive ist Joseph Plauts Haltung nur schwer nachzuvollziehen - und sie uns zu eigen zu machen, wäre weitaus mehr als eine fahrlässige Bequemlichkeit. Eine Verurteilung steht uns, um dies ganz deutlich zu sagen, nicht zu. Seine Antwort lautete: „Schwamm drüber“. Die extreme Verdrängungsleistung vieler dieser Betroffenen ist für uns als Phänomen, als eine von vielen möglichen Überlebensstrategien zu konstatieren. Plaut arbeitete weiter, liebte weiter die Bühne und den Auftritt. Hier in Detmold kannte ihn viele als liebenswürdigen Künstler, auch im Alter. Am 25. November 1966 starb Joseph Plaut mit 87 Jahren. Auf dem Grabstein für „Professor Plaut“ dokumentiert sich ein letztes Mal seine lebensbegleitende Haltung. Dort ist zu lesen: „Und doch, wär’s in die Wahl mir gegeben, ich führte noch einmal dasselbe Leben.“
Joseph Plaut erlebte die ebenso unzureichend wie falsch bezeichnete „Aufarbeitung“ der NS-Verbrechen, die zwei Jahre nach seinem Tod mit den sogenannten 68ern maßgeblich begann, nicht mehr. Er erlebte auch nicht, dass sich seine Heimatstadt Detmold der verantwortungsvollen Aufklärung und Dokumentation der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft seit Jahren verschreibt und damit anerkennt, dass Detmold für viel zu viele alles andere als wunderschön war. Das Landestheater Detmold stellt sich nun ein weiteres Mal der Geschichte und dokumentiert öffentlich, dass auch das Theater ein Ort eines antisemitischen Übergriffs war. Das Theater stellt sich damit öffentlich sichtbar auf die Seite des jüdischen Künstlers Joseph Plaut.
Ein hochkomplexes Spannungsfeld – auch im kulturellen Sinne – wird hier in Detmold mit der Gedenktafel einmal mehr als augenfällig. Denn schräg gegenüber dieser Tafel, die nun an den jüdischen Künstler Plaut und den Übergriff auf ihn erinnert, befindet sich eine Büste des Antisemiten Richard Wagner. 1941 war diese vor dem Eingangsportal des Theaters im Rahmen der Westwochen aufgestellt worden und blieb dort bis zum Ende des Krieges. Heute finden wir sie – gleichsam antipodisch - im Garten des „Prinzessinnen-Hauses“, in dem zeitweilig die HJ residierte.
Die Familie Plaut ist Teil der öffentlichen Erinnerung. Bislang finden wir den ermordeten Siegfried Plaut auf der Gedenktafel und auch im Detmolder Gedenkbuch. Joseph Plaut hingegen lebt noch in der persönlichen Erinnerung so mancher alter Detmolder weiter und erfährt heute auch durch diese Gedenktafel Ehrung, Respekt und Hochachtung.
Musik und Kultur in Theresienstadt
Vortrag in der Hochschule für Musik am 11. Februar 2023
von Gudrun Mitschke-Buchholz
„Gideon Klein ist zweifellos ein sehr bedeutendes Talent. Sein Stil ist der kühle, sachliche der neuen Jugend; man darf sich über diese merkwürdig frühe, stilistische Abklärung wundern. […] Unsere Jugend hat starke, intelligente Gehirne; hoffentlich vermag sie auch das Herz in den Kopf zu heben.“
„Assyrische Frühgeschichte, Die Blinden und ihre Umwelt, Chemie der Nahrungsmittel, Hundert Probleme der Technik des Alltags, Konjunktur und Wirtschaftskrise, Beruf und Ethik“ oder auch „Bilanz und Steuer“ bieten nur einen Ausschnitt aus den rund 500 hochkarätigen Vortragsveranstaltungen, die – so möchte man meinen – dem Angebot der Akademie der Wissenschaften entstammen. Weit gefehlt. Das Kaleidoskop kultureller Veranstaltungen lässt sich in beeindruckender und vielschichtiger Weise erweitern: Durch Musik mit Oper, Kammermusik, Chor- und Orchesterwerke und Swing, bildende Künste, Theater, Kabarett, eine große Bibliothek, Schriftsteller, Maler und viele Künstler von hohem Rang. Welchen Kosmos betreten wir? Die eingangs erwähnte Vortragsreihe wurde durch den sog. Orientierungsverein organisiert. Die durch Idealismus und wahrscheinlich auch durch Verzweiflung befähigten Mitglieder dieser Gruppierung hatten es sich zur Aufgabe gemacht, verirrte und verwirrte Menschen, die desorientiert auf den Straßen aufgefunden wurden, zu betreuen und ihnen so etwas wie die Gewissheit einer Seite des Menschseins unter die Füße auf dem sich auflösenden Boden zu bringen – als Gegenwelt ihrer alltäglich erlebten Realität, die Theresienstadt hieß.
Von Viktor Ullmann, einer der bekanntesten Komponisten, die in Theresienstadt inhaftiert waren, stammt die eingangs zitierte Passage aus seinen 26 erhaltenen Musikkritiken. Sie geben kostbare Einblicke in die kulturelle Szene des Ghettos. Die Darbietungen vieler Art spielten eine überaus wichtige Rolle in dieser Lebenswelt – sie waren eine Form der Bewältigung des Grauens mit künstlerischen Mitteln bis hin zu einem satirischen Blatt, das im Ghetto erschien. Kultur entstand und entfaltete sich unter den denkbar schlechtesten Bedingungen des Zwangsaufenthalts, des Verlustes, des Hungers, der Gewalt und der Verelendung. Sie wurde zum Ausdruck von Trost, Selbstvergewisserung, Illusion und Widerstand gleichermaßen. Für das Nebeneinander von Hochkultur und Hunger, Verzweiflung und Tod fand Viktor Ullmann in seinem Aufsatz „Goethe und Ghetto“ einen mehr als beredten Ausdruck.
Theresienstadt als Vorzeige- oder als Künstlerghetto entzieht sich nicht nur einer eindeutigen Zuordnung in das NS-Haftstättensystem. Theresienstadt wurde auch zu einem Mythos, zu einer Legende. Verklärt durch die Vorstellung, hier sei ein bevorzugter Ort nicht nur für deutsche Juden gewesen, für Prominente, Künstler und Wissenschaftler. Der Historiker Wolfang Benz bezeichnete dieses Ghetto, das keines im eindeutigen Sinne war, als „in seiner Einzigartigkeit exemplarischen Ort europäischer Geschichte“.
Dieser „einzigartige“ Ort war aus einer barocken Idealstadt europäischer Festungsbaukunst entstanden. Die sogenannte Kleine Festung, die Teil dieser Anlage war, wurde in der Habsburger Monarchie als Gefängnis für militärische und politische Gefangene genutzt. Im Juni 1940 wurde hier ein Polizeigefängnis der Prager Gestapo eingerichtet. Das „Gestapohaftlager“ bzw. „Polizeigefängnis“ diente fortan als Stätte der Verfolgung, der Folter und entfesselter Gewalt, die viele nicht überlebten. Die Gefangenen passierten am Eingang zum Hof der Kleinen Festung die Inschrift „Arbeit macht frei“.
Ende November 1941 wurde die Stadt in ein Ghetto in der „Großen Festung“ für insgesamt 150.000 Juden aus dem „Protektorat Böhmen und Mähren“ umgewandelt. Zu Theresienstadt gehörten zudem neun Außenlager, sog. Außenkommandos. In der Folgezeit wurde Theresienstadt als Konzentrations- und Durchgangslager für Juden auch aus Deutschland, Österreich, den Niederlanden, Dänemark und der Slowakei genutzt. Für die Deportation nach Theresienstadt genügte ein einziger Grund, und zwar der, jüdisch zu sein.
In Theresienstadt wurden ab November 1941 die Deportierten unter primitivsten Bedingungen in den Kasernen untergebracht. Ähnlich wie in anderen Ghettos und Konzentrationslagern wurde auch in Theresienstadt eine jüdische „Selbstverwaltung“ errichtet, die die Befehle der SS ausführen musste und kaum über Möglichkeiten verfügte, das Leben der Häftlinge zu erleichtern. Die Hoffnung der Häftlinge, dass Theresienstadt der Ort wäre, an dem sie bis zum Ende des Krieges würden leben und arbeiten können, ging schnell in die Brüche.
Theresienstadt war eine Station der „Endlösung der Judenfrage“ der nach der Wannseekonferenz 1942 in Gang gesetzten Tötungsmaschinerie. Und Theresienstadt hatte zudem die Funktion, die Welt über die Absichten der Nationalsozialisten zu täuschen. Nach innen und nach außen. Weder für die Weltöffentlichkeit noch für die Inhaftierten sogleich erkennbar funktionierte Theresienstadt als Durchgangsstation zu den Vernichtungslagern im Osten: Nach Auschwitz-Birkenau ging die Hälfte der 63 Transporte, die aus Theresienstadt abfuhren. So erhielt das vermeintliche Vorzeigeghetto den Beinamen „Wartehalle für Auschwitz“. Theresienstadt wurde in der NS-Propaganda zu weiteren Täuschungszwecken als sogenanntes „jüdisches Siedlungsgebiet“, Alters- und Vorzugsghetto für Juden über 65 Jahre und für diejenigen mit Kriegsauszeichnungen auf zynische Weise verklärt und als angebliche „jüdische Mustersiedlung“ ausländischen Delegationen vorgeführt. Den Menschen wurden sogenannte Heimeinkaufsverträge angeboten, in denen ihnen bis zu ihrem Lebensende angemessene kostenfreie Unterbringung, Verpflegung und ärztliche Versorgung zugesichert wurden. Als die Getäuschten und Betrogenen die Wirklichkeit des Lagers nach und nach erkannten, waren sie ihres Vermögens, ihrer Hoffnungen und ihres Glaubens an das Menschsein beraubt. Die harte Realität des Ghettos traf insbesondere die hochbetagten Menschen. Viele von ihnen überstanden Hunger, Seuchen, Wassermangel und die Leiden des Lagerlebens nicht lange. Für eine Person gab es durchschnittlich 1,4 m² Wohnfläche. Allein in der sogenannte Sudetenkaserne wurde eine größere Zahl Häftlinge untergebracht als die Stadt vor dem Krieg Einwohner hatte.
Wie gingen die Menschen mit dem perfiden Betrug, der Täuschung und dem Verlust all dessen, was sie bis dahin zu sein glaubten, um? Zu welchen Reaktionen waren die, manche Ghettobewohner in der Lage, in einer Welt, die eine Katastrophe war? Theresienstadt erzählt etwas von Überlebensstrategien, über die Kraft von Kunst und Kultur, über Selbstvergewisserung und persönliche, soziale und religiöse Identität – in einem Kosmos, in dem kaum mehr etwas Gültigkeit hatte, in dem Gewalt, Entwürdigung und Demütigung regierten. Es erzählt etwas über die Auflehnung gegen das Diktum, Juden seien Untermenschen, und damit zu wirklicher Kultur unfähig. Als die Machthaber die hohen künstlerischen Begabungen der Inhaftierten zu propagandistischen Zwecken missbrauchten, widerlegten sie damit ihre eigenen rassistischen Grundsätze.
Das kulturelle Leben in Theresienstadt wurde keineswegs von Anfang an durch die nationalsozialistischen Herren des Ghettos geduldet oder gar gefördert. Es entwickelte sich zunächst vielmehr aus dem privaten Bedürfnis und gegen die Absichten der Machthaber. So fanden sog. Kameradschaftsabende der Aufbaukommandos statt, bei denen zu Akkordeon gesungen wurde oder Abende, in denen im engsten Kreis mit den wenigen Instrumenten, die verblieben waren, musiziert wurde. Die SS gestattete nach einem anfänglichen Verbot offiziell den Besitz von Musikinstrumenten. Sie hatten offenbar den Gebrauchswert von Musik im Lagerleben im Sinn und wussten durch den Missbrauch der hochrangigen Kulturschaffenden die Weltöffentlichkeit systematisch zu täuschen. Dies unterscheidet sich zum Beispiel vom Mädchenorchester in Auschwitz insofern, als die Musik dort nicht zur Täuschung der Weltöffentlichkeit genutzt wurde, sondern vielmehr zur sadistischen Untermalung der Verbrechen.
Unter diesen unvorstellbaren Bedingungen wurden in Theresienstadt Kammermusik von Brahms, Beethoven, Mozart, Dvorák und Schubert und auch sinfonische Werke durch professionelle Kräfte und Laien zur Aufführung gebracht. Auch neue Musik entstand durch die inhaftierten Komponisten und brachte die ungeahnte Realität zu Gehör. Geprobt wurde nach schwerer Arbeit in kalten Kellern, krank, mit Hunger, zum Teil schlechten Instrumenten und ohne ausreichendes Notenmaterial – und angesichts des allgegenwärtigen Todes. Und dennoch oder gerade deswegen waren diese Proben und Konzerte für die Beteiligten eine lebenserhaltende Oase.
1942 konnte das erste Orchesterkonzert – die von Carlo Taube komponierte „Theresienstädter Sinfonie“ in der Magdeburger Kaserne stattfinden. Das Finale dieser Sinfonie erfasste die Hörenden zutiefst: Die ersten vier Takte von „Deutschland, Deutschland über alles“ wurden immer und immer wieder wiederholt, steigerte sich bis ein letzter Aufschrei „Deutschland, Deutschland“ sich nicht mehr bis „über alles“ fortsetzte, sondern in einer grauenvollen Dissonanz erstarb. Die Zuhörer wussten, wovon dieses Stück erzählte. Es vertonte ihre Lebensrealität und es zeigte, zu welchem Widerstand Menschen in der Lage sind. Menschen, deren physische Vernichtung beschlossen war.
In ständiger Erwartung des Todes brauchte es eine enorme seelische Kraft, um nicht seine Würde zu verlieren und zu schreiben, zu singen, zu rezitieren, zu malen. Die Musik hat wesentlich und wohl vor allen anderen Künsten dazu beigetragen, dass es in Theresienstadt ein Leben in Würde gab. Insofern steht die Musik im Mittelpunkt auch meiner Ausführungen über das kulturelle Leben im Ghetto. Dies heisst nicht, dass andere Künstler, wie Maler und Zeichner und damit die Chronisten des Lagers, von denen manche ihr Tun mit dem Leben bezahlten, nicht in meiner Achtung stehen würden. Genauso wenig die Kinder, deren Zeichnungen den Betrachter mit voller emotionaler Wucht treffen.
Den Grundstein des reichen Musiklebens in Th hatten die böhmischen Juden gelegt. Mit Viktor Ullmann, Pavel Haas, Hans Krása und Gideon Klein wurden ab 1941 die begabtesten tschechischen Komponisten nach Theresienstadt verschleppt. Sie waren Schüler von Schönberg, Zemlinsky und Janácek, sie hatten Erfolge gefeiert und als Pianisten und Dirigenten gewirkt, bis sie 1939 mit Arbeits- und Aufführungsverbot belegt und schließlich deportiert worden waren.
Es entfaltete sich durch die jüdischen Künstler ein reiches kulturelles Leben: Es gab mehrere Chöre, Kabarettgruppen, klassische und Unterhaltungsorchester (von manchen Kollegen der „ernsten“ Musik naserümpfend beargwöhnt), es gab die eingangs erwähnten Musikkritiken, Musikunterricht wurde erteilt und ein von Ullmann geleitetes „Studio für neue Musik“ eingerichtet. Deren wichtigsten Vertreter war Ullmann selbst, Hans Krása, Pavel Haas und auch Gideon Klein, die in unter den extremen Bedingungen des Ghettolebens komponierten und ihre Werke zur Aufführung brachten. In Theresienstadt waren Komponisten und Künstler aber auch sehr begabte Laien zahlreich vertreten, die versuchten, ihre Identität durch die Fortführung ihrer Tätigkeiten zu retten, anderen Häftlingen eine Stütze zu sein und das Menschsein nicht vergessen zu lassen.
Die von der SS seit der Gründung des Ghettos eingesetzte Selbstverwaltung hatte sich aller Belange des täglichen Lebens anzunehmen. Noch 1942 wurde vom Ältestenrat die offiziell genehmigte Abteilung „Freizeitgestaltung“ eingeführt. Die Mehrzahl der kulturellen Aktivitäten wurde von haupt- und nebenamtlich beschäftigten Gefangenen koordiniert. Neben Theater, Vortragswesen, Zentralbücherei und Sport umfasste sie eine sog. Musiksektion. Diese war unterteilt in die Sparten Opern- und Vokalmusik, Instrumentalmusik, Kaffeehausmusik und Instrumentenverwaltung. Sie schuf den organisatorischen Rahmen des geduldeten beziehungsweise erlaubten Musiklebens. Auch diese Institution musste auf jeden Wink der SS verfügbar sein.
Mitarbeiter der sogenannten Freizeitgestaltung, unter ihnen Viktor Ullmann, erhielten Vergünstigungen wie eine bessere Unterkunft, zusätzliche Lebensmittel und die Befreiung von Arbeitseinsätzen – zumindest bis zu ihrer eigenen Deportation. Für propagandistisch inszenierte und gefilmte Konzerte bekamen die Künstler eigens Konzertkleidung – weißes Hemd und Frack. Die Sicht auf ihre kaputten, eigentlich unbrauchbaren Schuhe wurde durch Blumendekorationen verdeckt.
In Theresienstadt waren somit Werke aus dem gängigen Konzert- und Opernrepertoire genauso zu hören wie neu komponierte Werke: Orchester- und Kammermusik kamen zur Aufführung, ebenso Oratorien, Lieder und auch Opern wie „Carmen“ und „Tosca“ oder Smetanas bei den Ghettobewohnern äußerst beliebte „Verkaufte Braut“ oder auch Operetten wie „Die Fledermaus“: „Glücklich ist, wer vergisst, was nicht mehr zu ändern ist“. Nicht nur die Operettenliebhaber unter Ihnen kennen diese Zeilen, die in dieser Welt eine ganz besondere Klangfarbe erhalten.
In dem ab Dezember 1942 eröffneten Kaffeehaus konnten die Ghettobewohner, die einen Berechtigungsschein ergattert hatten, Unterhaltungsmusik und Swing hören, was nicht durchgängig aber eigentlich auf dem Index stand. Der Swing-Gitarrist Coco Schumann, der als Neunzehnjähriger nach Theresienstadt kam, traf mit den „Ghetto Swingers“ auf ein herausragendes Jazz-Ensemble.
Das Kulturleben, das in schärfstem Gegensatz zu den täglichen Versuchen zu überleben stand, war propagandistisch gewünscht. Im Frühling 1943 begann eine „Stadtverschönerung“, deren Präsentation die Weltöffentlichkeit über den wahren Zweck des Ghetto belügen sollte. Bereits im Herbst 1942 waren „Geschäfte“ eröffnet worden, in denen allerding der bei Einlieferung beschlagnahmte Besitz der Häftlinge für wertloses Geld angeboten wurden. Das Kaffeehaus wurde errichtet; ein eigens errichteter Kindergarten existierten für genau den einen Tag, an dem die Besuchskommission erwartet wurde. Das mit großem Aufwand betriebene Täuschungsmanöver gelang auch vor der Kommission des Internationalen Roten Kreuzes im Sommer 1944, der ein Potemkinschen Dorf vorgeführt wurde. Ein idyllischer, frisch geputzter, mit Blumen geschmückter Ort, in dem Kulturveranstaltungen stattfanden, wo die noch vorzeigbaren Bewohner Theater oder Fußball spielten, wo Krásas Kinderoper Brundibar oder Verdis Requiem unter Rafael Schächter aufgeführt wurden und in dem Jazz zu hören war.
Dass die „Verschönerung“ eine Senkung des Häftlingsstandes verlangte, war Voraussetzung dieser zynischen Inszenierung. Vor allem kranke, elende Menschen, die der internationalen Kommission nicht vorgeführt werden konnten, ohne Verdacht zu erregen, wurden nach Auschwitz deportiert. Dies traf im Dezember 1943 5.000 Menschen, im Mai 1944 nochmals 7500.
Der Betrug funktionierte über die Maßen. Die Internationale Kommission des Roten Kreuzes bezeichnete Theresienstadt als „eine Stadt wie jede andere“, ein „Endlager“, von wo aus keine weiteren Deportationen stattfanden. Das wohl bekannteste Beispiel der Propagandalüge war ein "Dokumentarfilm" der in den frisch verschönerten Kulissen mit zwangsweise verpflichteten Häftlingen gedreht wurde, unter der Leitung des ehemaligen UFA-Stars Kurt Gerron. Unter dem Titel „Der Führer schenkt den Juden eine Stadt“ erlangte der Film eine entsetzliche Berühmtheit. Noch vor der Fertigstellung des Films begannen die Deportationen, die 18.500 Menschen trafen. Auch Kurt Gerron und seine Frau Olga bestiegen am 28. Oktober 1944 den Zug nach Auschwitz.
Die bedeutendsten Theresienstädter Musiker, Komponisten und Dirigenten, unter ihnen wiederum Viktor Ullmann, Hans Krása, Pavel Haas, Gideon Klein, Rafael Schächter und Karel Ancerl – sie alle wurden am gleichen Tag, dem 16. Oktober 1944, in einem Transport von 1.500 Menschen nach Auschwitz deportiert. 128 von ihnen überlebten.
Gideon Klein, dessen Streichtrio wir heute Abend hören werden, wurde von Auschwitz in das Außenlager Fürstengrube gebracht. Am 19. Januar 1945 begann wegen der nahenden Roten Armee die Evakuierung des Lagers. Über den Tod von Gideon Klein finden sich keine Dokumente. Wir wissen nicht, ob er zu den 250 Menschen gehörte, die sofort erschossen wurden, oder ob er noch auf den Todesmarsch nach Gleiwitz getrieben wurde, um im offenen Bahnwaggon bei minus 20° über Mauthausen nach Mittelbau-Dora transportiert zu werden. Und wir wissen auch nicht, ob er zu den Geschundenen gehörte, die diesen Transport nicht überlebten und dessen Leichen entlang der Bahnschienen gefunden wurden.
Nach der Deportation der führenden Künstler verstummte Theresienstadt keineswegs. Es erfolgte wiederum zu politisch-propagandistischen Zwecken der erneute Aufbau eines Kulturlebens, zum einen durch die verbliebenen Insassen, zum anderen durch neu ankommende Häftlinge. Die Fluktuation war durch die Transporte entsprechend. Auch die Neuankömmlinge spielten um ihr Leben und versuchten, sich auf diese Weise eine Gegenwelt zu erschaffen. Auch sie spielten fatalerweise dadurch eine entscheidende Rolle als Propagandainstrument – missbraucht als Werkzeug ihrer Unterdrücker.
Dennoch: Durch Auftritte in Alters- und Sterbeheimen, durch die Betreuung neu ankommender Künstler, durch ihre Wahrnehmung erzieherischer, bildungspolitischer und psychologischer Möglichkeiten dienten sie angesichts des nahenden Todes der Überlebenshilfe für sich selbst und ihre Zuhörer gleichermaßen.
Vergessen Sie nicht bei all der Faszination durch ein reiches, beeindruckendes kulturelles Leben in Theresienstadt: Von den etwa 141.000 Häftlingen erlebten 23.000 das Ende des Krieges. Aber erlebten sie eine Befreiung? Die anderen hatten die gegenmenschlichen Bedingungen, sie hatten Krankheit, Seuchen, Hunger und Gewalt nicht überlebt.
Theresienstadt, jener unfassbare Ort, über den zu reden auch ein ganzer Abend nicht ausreichte, wurde in der Rezeption und in der Erinnerungskultur bisweilen zur Legende. Im kulturellen öffentlichen Gedächtnis wird dieser Ort oftmals missverstanden als ein Ghetto, an den die Juden zwar zwangsweise deportiert wurden, an dem aber musiziert, komponiert, gemalt, gelehrt, gezeichnet und Lyrik verfasst wurde.
Die Geschichte Theresienstadts ist durch den Zynismus der Täter geprägt. Die Weltöffentlichkeit wurde planmäßig über den Zweck der Einrichtung getäuscht und von den Absichten genozidaler Politik abgelenkt. Und schließlich wurden die Opfer dazu missbraucht, bei dieser Täuschung mitzuwirken. Wenn wir den Klischees vom faszinierenden Kultur-Ghetto, vom Vorzugslager für 40.000 deutsche Juden Glauben schenkten, redeten wir der systematischen, gewollten Lüge, des inszenierten Betrugs, der Täuschung das Wort. Und vergessen wir nicht all die Menschen, die kein Instrument spielten, die nicht sangen, nicht schrieben und auch nicht lehrten. Die weder prominent noch privilegiert noch irgendwie begünstigt waren. Erinnert sei an die Menschen, die in Theresienstadt leise, unbekannt um ihr Leben gebracht wurden.
Das Streichtrio von Gideon Klein und auch die Reflektionen von Ruth Klüger, die nicht nur Theresienstadt überlebte, zeugen von einer Welt der Gegenmenschlichkeit, die jenseits unserer Vorstellungen ist und die aus meiner Sicht in seiner Komplexität angemessen darzustellen oder gar zu begreifen nicht möglich ist. Musik und Kultur von Menschen aus Theresienstadt sind vor diesem Hintergrund Kostbarkeiten, die unserer Wahrnehmung – so hoffe ich – etwas sehr Wertvolles zugrunde legen: nämlich Hochachtung.