C_Biographien
geb. 31.03.1888 in Detmold
| Religionszugehörigkeit: | jüdisch |
| Eltern: | Theodora Meyer, geb. Meyer (30.07.1861 - 1915) aus Oerlinghausen und Eduard Meyer, Pferdehändler aus Herford |
| Geschwister: | Carl Meyer (geb. 25.03. 1882 in Herford, gest. in Bolivien) Dr. jur. Gustav Meyer (06.06.1884 in Herford - 19.05.1944 in Theresienstadt) Rudolf Meyer (07.08.1886 in Detmold - 23.08.1914, vermutlich gefallen) Dr. Max Meyer (geb. 28.05.1890 in Herford) Johann Georg Meyer (geb. 13.05.1893 in Herford) Ruth Meyer (geb. 26.04.1896 in Detmold?) |
| Ehemann: | Salomon Cohn |
| Neffe: | Erich Adolf Cohn |
| WeitereVerwandte: | Hedwig Cohn, geb. Rosenthal (geb. 06.01.1885 in Wiesbaden) |
| Beruf: | Hausfrau |
| Wohnorte: | Detmold, Werrestr. 2 Siegen Nizza, 105 PDE des Anglais |
Lina Cohn wurde in Detmold in eine große Familie geboren. Aufgrund der Quellenlage ist lediglich bekannt, dass sie aus Nizza kommend am 5. März 1944 mit dem Transport Nr. 70 im Sammel- und Durchgangslager Drancy mit der Nummer 16374 registriert wurde. Am 27. März 1944 wurde Lina Cohn nach Auschwitz deportiert. Dort verlieren sich ihre Spuren. Ihr Todesdatum ist nicht bekannt.
Ihr Bruder Gustav wurde zusammen mit seiner Frau Therese, geb. Melchior mit dem Transport XI/2 Nr. 26 und 27 am 12. Mai 1943 nach Theresienstadt deportiert. Gustav Meyer kam dort am 15. Mai 1944 um.
QUELLEN: LAV NRW OWL P 3|4 Nr. 900; StdA Siegen; Archiv und Museum der Gedenkstätte Auschwitz; www.ushmm.org; Rainer Ebel, Oerlinghausen; Arolsen Archives
- Details
geb. 05.07.1898 in Detmold
| Religionszugehörigkeit: | jüdisch |
| Eltern: | Albert Examus und Clara Examus, geb. Meyer |
| Ehemann: | Alfred Cohnheim (geb. 5.10.1889 in Gleidingen) |
| Söhne: | Fritz Cohnheim (geb. 14.08.1923 in Hannover) Hans-Werner Cohnheim (geb. 12.05.1926 in Gleidingen) |
| Wohnorte: | 13.08.1923 Gleidingen Krs. Hildesheim, Ellernstr. 16 seit 1939 Gleidingen, Haus Nr. 138 (heute Hildesheimer Str. 563) gemeldet Hannover, Wunstorfer Landstr. 1 |
Alice Examus, verh. Cohnheim wurde in Detmold geboren, ihr Lebensmittelpunkt war jedoch seit ihrer Heirat mit Alfred Cohnheim und der Familiengründung Gleidingen. Ihre Familie lebte dort vom Viehhandel.
Ihre Fluchtvorhaben in die USA, nach Palästina oder Bolivien konnten nicht realisiert werden. Alice Cohnheim wurde in eines der sog. Judenhäuser - Israelitische Gartenbauschule, Wunstorfer Landstraße in Ahlem - zwangseingewiesen. Am 26. März 1942 sollten die Menschen von dort in das Ghetto Trawniki deportiert werden. Allerdings wurde das ursprüngliche Transportziel abgeändert und der Deportationszug ging das Warschauer Ghetto.
(S. hierzu auch Adam Czerniakow: Im Warschauer Ghetto.- München 1986, S. 240)
Alice Cohnheim und auch ihre beiden Söhne wurden für tot erklärt. Als amtliches Todesdatum wurde der 31. Dezember 1945 festgesetzt.
QUELLEN: LAV NRW OWL D 87 Nr. 15; StdA Hannover; StdA Hildesheim; Stadt Laatzen; www.spurenimvest.de; Arolsen Archives
Zur Familiengeschichte Examus s. Joachim Kleinmanns: Die jüdische Familie Examus in Detmold. In: Rosenland 29/2024, S. 74ff.
- Details
auch: Kronberger
04.03.1915 in Detmold - Februar 1945 im Konzentrationslager Groß-Rosen
| Religionszugehörigkeit: | evangelisch |
| Eltern: | Minna (Mimi) Cronberger, geb. Kruse, ab 1924 verh. Röhler (geb. 10.01.1895 in Detmold) und Alfred Cronberger (geb. 18.05.1888 in Hamburg), Pianist |
| Stiefvater: | Otto Röhler, Stuckateur |
| Geschiedene Ehefrau: | Louise Cronberger, geb. Gröhnermein, verw. Krause (geb. 10.01.1911 in Wüsten) |
| Beruf: | Hausdiener, Kellner |
| Wohnorte: | Detmold, Carlstr. 3 bei den Eltern Detmold, Leopoldstr. 18 03.04.1916 Detmold, Lagesche Str. 33 16.10.1916 Nienhagen 17.01.1917 Detmold, Meiersfelderstr. 49 bei der Mutter 29.07.1917 Nienhagen Nr. 22 01.01.1925 Detmold, Feldstr. 25 bei Otto Röhler Im Knabenhof v. Stephansstift Hannover-Kleefeld Von Freistatt Kr. Sulingen 29.03.1931 Detmold, Lagesche Str. 49 bei Röhler abgemeldet am 17.06.1931 nach Bad Meinberg Nr. 19 01.07.1931 Detmold, Lagesche Str. 79 bei O. Röhler 15.11.1931 - 05.01.1932 Detmold, Wiesenstr. 5, Vereinshaus ["Die Burse"] 01.03.1932 abgemeldet nach Nienhagen Amt Detmold bei Kruse Von Bleisheim: 06.06.1934 Detmold, Friedrichstr. 16 bei Röhler 15.12.1935 Detmold, Paulinenstr. 49 bei Röhler 12.02.1937 Detmold, Seminarstr. 10 22.03.1937 abgemeldet nach Lemgo, Hotel Wülke Von Bad Salzuflen, Begakamp 1 23.10.1937 mit Familie Detmold, Römerweg 9 bei Tr[...] 11.08.1939 abgemeldet nach Aachen-Eilendorf, Marienstr. 44 28.02.1940 dort abgemeldet |
Alfred Cronberger verbrachte seine ersten Lebensjahre in Detmold und Lippe und wuchs offenbar unter schwierigen Bedingungen auf. Sein Vater war den Meldeunterlagen zufolge mehr als vier Jahre in Haft. Als er neun Jahre alt war, heiratete seine Mutter ein zweites Mal. Alfred Cronberger wurde für einige Zeit in einer Erziehungsanstalt, dem Knabenhof im Stephansstift in Hannover untergebracht. In den verschiedenen Erziehungsheimen des Heimverbundes Stephansstift lebten bis zu 700 Jungen gleichzeitig und sahen sich entsprechenden "Erziehungsmethoden" ausgesetzt.
Mit sechzehn Jahren kehrte Alfred Cronberger zurück nach Detmold, wo er zeitweilig wieder bei seiner Mutter und seinem Stiefvater lebte. Er arbeitete an verschiedenen Orten als Kellner und Hausdiener. Offenbar wurde Alfred Cronberger im Laufe seines weiteren Lebens straffällig, was allerdings aufgrund der schwierigen Quellenlage nicht eindeutig durch Prozessunterlagen o. ä. dokumentiert werden kann. Belegt ist allerdings seine Inhaftierung als sog. Berufsverbrecher (Häftlingskategorie BV (eigentlich: Befristeter Vorbeugehäftling), Häftlingsnummern 450, 29720) im Konzentrationslager Groß-Rosen. Seine Häftlingsnummer lässt darauf schließen, dass er dort im Mai 1941 eingeliefert worden war.
Im Februar 1945 wurde das Lager von der SS geräumt, die Häftlinge deportiert oder auf Todesmärsche geschickt. Laut Auskunft der Gedenkstätte Groß-Rosen wurde Alfred Cronberger im Februar 1945 durch einen SS-Mann erschossen.
In einem ab Mai 1967 geführten Prozess vor dem Landgericht Braunschweig gegen den letzten Lagerkommandanten von Groß-Rosen, Johannes Hassebroek, wegen Mordes an zwölf Häftlingen in diesem Konzentrationslager wurden Angaben zur Person und zum Schicksal der Erschossenen von der Staatsanwaltschaft Braunschweig angefordert. Darunter auch die von Alfred Cronberger. Es ist demnach nicht auszuschließen, dass er zu diesen Ermordeten gehörte.
Gegen Johannes Hassebroek wurden drei Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Braunschweig wegen Mordes an Insassen verschiedener Lager geführt. In dem Verfahren von 1967 wurden die Taten vom Braunschweiger Landgericht allerdings als Totschlag gewertet. Wegen der Verjährung dieses Straftatbestandes wurde Hassebroek im Juni 1970 freigesprochen. Das Urteil wurde durch den Bundesgerichtshof bestätigt.
QUELLEN: StdA DT MK; StdA Braunschweig; Archiv der Gedenkstätte Groß-Rosen; Niedersächsisches Landesarchiv Abt. Staatsarchiv Wolfenbüttel; Archiv der Dachstiftung Diakonie Gifhorn; Arolsen Archives
- Details
28.03.1917 in Braunenbruch bei Detmold - 15.04.1942 im Konzentrationslager Sachsenhausen
| Religionszugehörigkeit: | katholisch |
| Eltern: | Kunigunde Cybulski, geb. Sperber und Leon Cybulski |
| Ehefrau: | Stanislawa Cybulska, geb. Cybulski |
| Beruf: | Landwirt |
| Wohnorte: | Braunenbruch b. Detmold Ksiestwo bei Lodz Bruzyca Wielka, Kreis Litzmannstadt (1943-1945 unter deutscher Besatzung Breitbruschütz) |
Johann Cybulski wurde auf dem Gut Braunenbruch bei Detmold als Sohn eines Polen und einer Deutschen geboren. Später lebte er als Landwirt mit seinen Eltern und seiner Frau in Ksiestwo im damaligen Kreis Litzmannstadt.
Im besetzten Polen wurde Johann Cybulski verhaftet und am 10. Mai 1940 in das Konzentrationslager Dachau als sog. Schutzhäftling eingeliefert und erhielt die Häftlingsnummer 10387. Am 31. August 1940 wurde er mit insgesamt eintausend Menschen mit dem Transport VII aus Dachau in das Konzentrationslager Sachsenhausen überstellt. Davon waren 906 sog. Schutzhäftlinge, 750 von ihnen waren Polen. Johann Cybulski wurde in Sachsenhausen nun in der Häftlingskategorie ‚polnischer Häftling' mit der Häftlingsnummer 30315 registriert.
Nach Beginn des Zweiten Weltkrieges wurden zehntausende Menschen aus den besetzten Ländern nach Sachsenhausen verschleppt. Darunter befanden sich politische Gegner des Nationalsozialismus bzw. der kollaborierenden Regierungen, ausländische Zwangsarbeiter sowie alliierte Kriegsgefangene. 1944 waren rund 90 Prozent der Häftlinge Ausländer. Die größte Gruppe stellten Bürger der Sowjetunion und Polen.
Johann Cybulski kam am 15. April 1942 in Sachsenhausen um. Als offizielle Todesursache wurde Herzschwäche bei allgemeiner Körperschwäche angegeben.
QUELLEN: LAV NRW OWL P 3|4 Nr. 1122; KZ-Gedenkstätte Dachau; Gedenkstätte und Museum Sachsenhausen; Arolsen Archives
DOKUMENTE
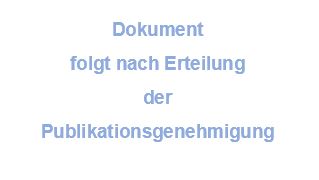
Eintrag für Johann Cybulski im Zugangsbuch des KZ Dachau
Thbn.png)
Schreibstubenkarte für Johann Cybulski im KZ Dachau, o. D. (1.1.6.7-10629729-ITS Digital Archive, Arolsen Archives)
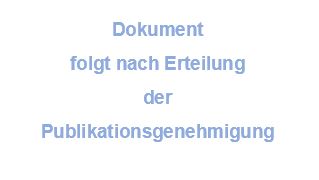
Transportliste aus dem KZ Dachau, Transport VII am 30. August 1940
, Rep. 35 H KZ Sachsenhausen Nr. 3-3)Thbn.png)
Abschrift des Eintrags für Johann Cybulski im Sterbebuch des Standesamts Oranienburg v. 28.09.1948 (Brandenburg. Landeshauptarchiv (BLHA), Rep. 35 H KZ Sachsenhausen Nr. 3-3)
- Details
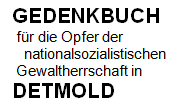


Thbn.png)
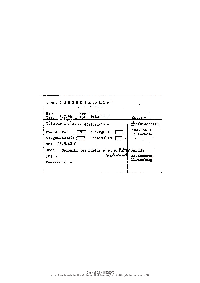

Thbn.png)
Thbn.png)
Thbn.png)