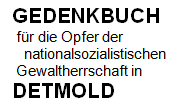Geb. 17.07.1901 auch 1902, auch 24.06.1902, 17.07.1901 in Rozniatow (Galizien, heute: Roschnjatiw/Westukraine)
| Religionszugehörigkeit: | jüdisch |
| Eltern: | Ita (Ida, Jette) Soltys-Gottlieb, geb. Bleicher (geb. 30.11.1873 in Rozniatow, 25.09.1934 nach Rotterdam) und Max (Meier Meylich) Soltys recte Gottlieb1 (01.03.1874 in Rozniatow - 09.08.1930 in Detmold), Kaufmann |
| Geschwister: | Hermann/Chaim Soltys-Gottlieb (1897-1985) Adolf Soltys-Gottlieb (14.07.1899 in Rozniatow-1922) Anna (Chana) Vogelhut, geb. Soltys-Gottlieb (geb. 06.01.1906 in Rozniatow) Bertha Schwarzbaum, geb. Soltys-Gottlieb (geb. 10.11.1909 in Detmold), Stenotypistin Albert Soltys-Gottlieb (04.10.1911-1983), Uhrmacher Frieda (Friedchen) Tichauer, geb. Soltys-Gottlieb (geb. 13.05.1913 in Detmold) |
| Schwager: | Josef Leib (Leo) Vogelhut |
| Ehemann: | Emanuel Gutwer, auch Gutfer (19.08.1896 in Przedburg - [1942]), Kaufmann, Schuster |
| Tochter: | Gerda Gutwer (geb. 09.03.1928 in Langendreer) |
| Beruf: | Schneiderin, Kauffrau |
| Wohnorte: | Rozniatow 05.11.1908 Detmold, Krumme Str. 27 02.05.1925 Detmold, Bruchmauerstr. 42 15.08.1926 Langendreer, Kaiserstr. 164 1928 Langendreer, Adolfstr. 26 1930/31 Bochum-Langendreer, Auf dem Helwe 1 Langendreer, Bockholtstr. 1 Antwerpen, Lange Ataarstraat 11 Antwerpen, Lamorinièrestraat 103 Vaudreuille |
Hedwig Bleicher gen. Soltys-Gottlieb, verheiratete Gutwer stammte aus Galizien, das in seiner wechselvollen Geschichte bis 1918 zu Österreich und nach dem Ende des Ersten Weltkrieges zu Polen gehörte, und zählte somit zu den sogenannten Ostjüdinnen und -juden. Sie war laut ihren Einbürgerungsunterlagen die nichteheliche Tochter von Ita Bleicher, verheiratete Soltys-Gottlieb. Möglicherweise war die Ehe der Eltern vor einem Rabbiner geschlossen worden und nicht vor einer staatlichen Institution, so dass nicht nur Hedwig als nichtehelich galt. In vielen ostjüdsichen Familien wurde die staatlich anerkannte Eheschließung nachgeholt. Ihre Familie war vor Not, vor judenfeindlichen Übergriffen und aus Angst vor Pogromen geflohen und war seit November 1908 unter schwierigen Bedingungen in Detmold ansässig. Ihre wiederholten Bemühungen um Einbürgerung aus dem Jahr 1919, die sämtlich abgelehnt wurden, dokumentieren ihren als nicht nur von der lippischen Landesregierung problematisch angesehenen sozialen Status als "Ostausländer". Erst 1923 erhielt die Familie ihre Einbürgerungsurkunde. Diese Einbürgerung wurde allerdings für Ita Soltys-Gottlieb und ihre noch bei ihr lebenden Töchter Bertha und Frieda im Januar 1934 widerrufen. Da Hedwig durch ihre Heirat im Jahr 1926 mit dem aus Polen stammenden staatenlosen Kaufmann Emanuel Gutwer ebenfalls als staatenlos galt, traf sie dieser Widerruf nicht mehr.
Hedwig Soltys-Gottlieb erlernte den Beruf der Schneiderin. Am 10. August 1926 heiratete sie den Kaufmann und Schuster Emanuel Gutwer und zog zu ihm nach Bochum-Langendreer. Zu ihrer beruflichen Tätigkeit liegen unterschiedliche Informationen vor: Laut Aussage ihrer Schwester Frieda Tichauer hätten sie dort mit einer Angestellten ein gut gehendes Textilwarengeschäft betrieben. Dokumenten aus ihrem späteren Fluchtort Antwerpen zufolge, betrieben Emanuel und Hedwig Gutwer ein Schuhgeschäft. 1928 wurde ihre Tochter Gerda geboren. Wiederum Angaben Frieda Tichauers zufolge zwangen die Familie Gutwer bereits im Mai 1933 Angriffe auf das Geschäft, das u. a. mit Drohungen beschmiert und verwüstet wurde, zur Flucht. Ihren Plan nach Palästina auszuwandern, konnten sie jedoch nicht in die Tat umsetzen. Mit ihrem Mann und ihrer Tochter floh sie zunächst nach Antwerpen, wo sie seit dem 28. Mai 1933 offiziell als "aus rassischen Gründen" Verfolgte registriert wurden.Trotz aller Widrigkeiten konnte Emanuel Gutwer auch in Antwerpen noch ein kleines Schuhgeschäft eröffnen. Hedwig Gutwer verdiente etwas für den Lebensunterhalt durch Näharbeiten. Als die Niederlande, Luxemburg und Belgien am 10. Mai 1940 als Teil des Westfeldzugs von der Wehrmacht überfallen worden war und Belgien am 28. Mai 1940 kapitulierte, musste die Familie wiederum fliehen. Sie wurden umgehend am 10. Mai 1940 als geflüchtet registriert. Hedwig Gutwer floh mit ihrem Mann und ihrer Tochter weiter nach Frankreich in die kleine Gemeinde Vaudreuille, südöstlich von Toulouse in der Haute Garonne. Hier lebten relativ abgeschieden nur 128 Bewohnerinnen und Bewohner zu denen im Zuge der Fluchtbewegung noch etwa achtzig Geflüchtete kamen, unter ihnen die Familie Gutwer. Auch in diesem Dorf arbeitete Emanuel Gutwer als Schuhmacher und reparierte gege Naturalien das Schuhwerk der Dorfbewohner. Der dortige Bürgermeister Paul Juilla und dessen Familie mit waren freundschatlich mit den Gutwers verbunden und konnten zumindest eine zeitlang Schutz bieten. Aus Vaudreuille stammte Hedwig Gutwers letzte Nachricht an ihre Schwester Frieda, in der sie mitteilte, in dem kleinen Ort nicht lange bleiben zu wollen bzw. zu können. Eine erhaltene Postkarte aus Bochnia in Polen (hier hatten die Deutschen im März 1941 ein Ghetto errichtet) vom 1. Oktober 1941, die Anna Vogelhut über Lissabon an ihren Bruder Chaim Hermann - er nannte sich nun Soltes - in die USA sandte, zeugt von ihrer Sorge auch um ihre Schwester Hedwig und deren Familie, die sich auf keinerlei sonstige Unterstützungsmöglichkeiten berufen konnten. Chaim Hermann Soltes hatte jedoch offenbar dargelegt, seine Schwester in den USA nicht aufnehmen zu können. "Der Allmächtige soll uns jeder wieder mit unseren Lieben zusammenführen, damit unser Herz nicht so betrübt ist." So verdeutlichte Anna Vogelhut auf dieser Postkarte nicht nur ihre Not und ihre Verfasstheit, sondern wohl insgesamt die der Geflüchteten und Verfolgten.
Ein Entkommen ins rettende Ausland und damit in die Freiheit gelang der Familie Gutwer nicht. In Frankreich hatten die im März 1942 begonnenen Deportationen im Sommer 1942 ihren Höhepunkt erreicht. Emanuel Gutwer konnte eine Einweisung in das Arbeitslager Muret im April 1942 noch umgehen. Als Ende August allerdings Razzien des Vichy-Regimes in der unbesetzten Zone durchgeführt wurden, die zur Verhaftung tausender Juden führte, wurde Emanuel Gutwer zunächst in Muret eingewiesen und von dort in das Internierungslager Camp der Noé gebracht. Hedwig und Gerda Gutwer blieben ohne ihn zurück in Vaudreuille und wurden dort am 26. August 1942 verhaftet und ihrer Deportation preisgegeben. Vermutlich waren sie durch einen Nachbarn denunziert worden.
Die Internierten aus dem Lager Noé, so auch Emanuel Gutwer, wurden in das Sammel- und Durchgangslager Drancy gebracht. Es handelte sich um einen Transport von insgesamt 501 Juden, die auch aus den Lagern Gurs und Le Fauga kamen. Am 2. September 1942 trafen sie in Drancy ein. Auch Hedwig und Gerda Gutwer wurden nach Drancy verschleppt. Ein genaues Datum ihrer Einlieferung ist nicht überliefert. Von dort wurden Hedwig, Emanuel und Gerda Gutwer am 4. September 1942 mit dem Transport Nu, der insgesamt 1013 Menschen umfasste, in verschlossenen Viehwaggons nach Auschwitz deportiert. Lediglich zum Herausholen der toten Menschen, die die katastrophalen Bedingungen des Transports nicht überlebten, wurden ein einziges Mal auf einem Halt des Zuges die Türen geöffnet.
Als der Transport am 6. September 1942 in Auschwitz eintraf, waren zuvor zweihundert junge und arbeitsfähige Männer in Kosel, 80 km vor Auschwitz, aus dem Zug geholt worden, um in verschiedenen Lagern der Umgebung eingesetzt zu werden. Noch sechzehn Männer und 38 Frauen dieses Transports wurden als arbeitsfähig selektiert. Die anderen Menschen wurden unmittelbar nach ihrer Ankunft, wie es offiziell hieß, einer "Sonderbehandlung" zugeführt und in den Gaskammern ermordet. Recherchen vor allem des Ehepaars Klarsfeld ergaben, dass nur 27 von den ursprünglich 1013 Menschen aus diesem Transport überlebten. Hedwig, Emanuel und Gerda Gutwer gehörten nicht zu ihnen.
Hedwig Gutwer gilt offiziell als verschollen.
Durch eine Gedenktafel in Vaudreuille wird an die Familie Gutwer erinnert. Vor allem durch detaillierte und weitreichende Recherchen eines Nachfahren des Bürgermeisters Paul Juilla und dessen Familie erhält die Familie Gutwer ein ehrendes Gedenken.
1 In Verzeichnissen zu jüdischen Namen aus Galizien verbindet das Wort recte auch den Familiennamen des Vaters und den Familiennamen der Mutter, wenn die Kinder als nichtehelich eingestuft wurden. Möglicherweise ist dies aber auch in der vom offiziell geltenden Namens- und Personenstandsrecht abweichenden Tradition der galizischen Juden begründet.
QUELLEN : LAV NRW OWL L 79 Nr. 490, 491, L 80.04 Nr. 1228, 1229, D 1 Nr. 14074, 14208, D 106 DT Nr. 748, 752, 754; StdA DT MK; StdA Bochum; Le Mémorial de la déporation des juifs de France, Beate und Serge Klarsfeld, Paris 1978; Arolsen Archives; Thomas Algans, Frankreich
Zu Bochnia s. www.sztetl.org.pl
zurück zur alphabetischen Namensliste zu den Verzeichnissen
DOKUMENTE
Thbn.jpg)
Meldekarte für Hedwig Gutwer (StdA DT MK)
 Vogelhut, 1.10.1941 (D1 BEG Nr. 1075)Thbn.jpg)
Postkarte von Chana (Anna) Vogelhut, 1.10.1941 (LAV NRW OWL D1 BEG Nr. 1075)

Letzte erhaltene Postkarte von Emanuel Gutwer, Camp de Noé an Paul Juilla, Vaudreuille, o. D. (Sammlung Thomas Algans)
 Thbn.jpg)
Eidesstattliche Versicherung von Frieda Soltys-Gottlieb, o. D. (LAV NRW OWL D1 BEG Nr. 1075)