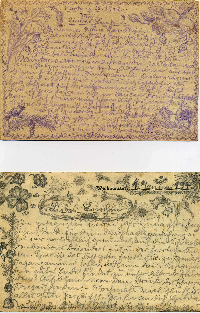H_Biographien
geb. 15.11.1891 in Bielefeld
| Religionszugehörigkeit: | jüdisch |
| Schwester: | Elfriede Dampf, geb. Heine (26.11.1888 - 30.11.1941) |
| Neffe: | Walter Dampf (geb. 28.12.1918 in Salzburg) |
| Ehefrau: | Sophie Heine, geb. Cohen (geb. 17.04.1896 in Bonn), Hausangestellte |
| Beruf: | Handlungsgehilfe |
| Wohnorte: | Bielefeld 21.04.1909 Detmold, Elisabethstr. 5 bei Michaelis 30.10.1909 Bielefeld 1912/13 Münster Bielefeld: Neuenkirchener Str. 2 07.04.1926 Löbellstr. 11 15.03.1927 Viktoriastr. 45 01.06.1934 Nebelswall 6 04.05.1937 Turnerstr. 7 11.11.1938 Kavalleriestr. 16 [Letzter Wohnort Bielefeld, Niedernstr. 39] |
Robert Heine lebte für kurze Zeit in Detmold und war hier noch als Schüler gemeldet. In Bielefeld führte er die einzige für Juden zugängliche Gaststätte, die sich neben der Behelfssynagoge in der Turnerstraße 5 befand.
Als sog. Aktionsjude wurde er im Rahmen des Novemberpogroms 1938 nach Buchenwald deportiert (Häftlingsnr. 28757), wo er vom 12. November bis 23. Dezember 1938 inhaftiert war. Auch Robert Heine musste in Bielefeld Zwangsarbeit leisten.
Am 10. Dezember 1941 musste sich Robert Heine mit seiner Frau Sophie zunächst im traditionsreichen Lokal Kyffhäuser am Kesselbrink in Bielefeld einfinden, das nun als Sammellager diente. Am 13. Dezember 1941 wurden sie nach Riga deportiert. Dort wurden beide ermordet.
Im Haushalt des Ehepaars Heine lebte ab 1928 ihr Neffe Walter Dampf. Er war der Sohn von Robert Heines Schwester Elfriede und Albert Dampf (geb. 01.07.1893 in Salzburg). Walter Dampf gelang am 15. Juli 1939 die Flucht nach England. Seine Mutter, die 1919 mit ihrem Mann zunächst nach Bremen, später nach Berlin gezogen war, wurde am 26. November 1941 von Berlin nach Riga deportiert. Dort wurde sie am 30. November 1941 direkt nach ihrer Ankunft bei Massenerschießungen im Wald von Rumbula ermordet.
QUELLEN: StdA DT MK; StdA Bielefeld 104, 2.20 Nr. 100-1891,2; 104, 3 Nr. 18, 21; Arolsen Archives
LITERATUR: Minninger, Meynert, Schäffer (1985)
- Details
geb. 21.08.1888 in Detmold
| Religionszugehörigkeit: | jüdisch |
| Ehemann: | Sigmund Heineberg (geb. 11.04.1877 in Brakel) |
| Tochter: | Lotte Heineberg (geb. 05.08.1916 in Holzminden) |
| Beruf: | "Witwe" |
| Wohnorte: | Detmold, Lange Str. 39 Holzminden Hannover: 14.12.1936 Wittekamp 56 05.04.1939 Adolf Hitlerplatz 7 01.02.1940 Wissmannstr. 13 04.09.1941 Auf dem Emmerberge 31 15.12.1941 Riga, "abgesch. amtl." |
Gretchen Heinberg verbinden ihre ersten Lebensjahre mit Detmold. Am 15. Dezember 1941 wurde sie aus dem sog. Judenhaus Auf dem Emmerberge in Hannover von der Sammelstelle Ahlem nach Riga deportiert.
Gretchen Heineberg wurde 1950 durch das Amtsgericht Hannover für tot erklärt. Als amtliches Todesdatum wurde der 8. Mai 1945 festgesetzt.
QUELLEN: LAV NRW OWL D 20 A Nr. 10146, 10458, D 20 B Nr. 3203; Deutsch Israelische Gesellschaft Hannover; StdA Hannover
LITERATUR: Buchholz (1987)
- Details
06.04.1897 in Münster - 21.04.1944 Heil- und Pflegeanstalt Lindenhaus, Lemgo-Brake
| Religionszu-gehörigkeit: | evangelisch |
| Eltern: | Helene Stellbrink, geb. Kirchhoff (geb. 04.06.1862 in Hagen) und Carl Stellbrink (16.08.1855 - 08.05.1930), Oberzollsekretär |
| Geschwister: | Helene Stellbrink (geb. 16.03.1892 in Münster) Karl Friedrich Stellbrink (28.10.1894 in Münster - 10.11.1943 in Hamburg hingerichtet) Magdalene Brinkmann, geb. Stellbrink (geb. 24.09.1902 in Detmold) |
| Ehemann: | Hugo Heiss, Bergmann aus Langendreer |
| Kinder: | Ewald Heiss (geb. 02.06.1920 in Langendreer) Hugo Heiss (geb. 1923) Meta Heiss (26.02.1925 in Detmold -25.10.1925 in Detmold) |
| Wohnorte: | 15.08.1902 Hiddeser Str. 5 bei den Eltern 02.03.1916 Halberstadt 01.09.1916 Detmold, Hubertusstr. 10 bei den Eltern 12.04.1917 Potsdam 20.11.1917 Detmold, Hubertusstr. 10 01.09.1919 Langendreer 05.10.1920 Detmold, Hubertusstr. 10 bei den Eltern 25.10.1920 Langendreer Bielefeld, Spindelstr. 7 14.05.1926 Detmold, Hubertusstr. 10 bei den Eltern 10.06.1926 Anstalt Lindenhaus bei Lemgo 17.09.1927 Remmighausen Bahnhof 15.11.1927 "soll sich im Krankenhaus Bielefeld aufhalten" 05.01.1928 Detmold, Obere Str. 19 bei Addicke 04.01.1928 Detmold, Friedrichstr. 16 bei Gröne 09.07.1928 "soll sich in der Provinzial-Heilanstanstalt Münster befinden" 30.07.1928 "jetzt in der Heilanstalt Lengerich" |
Durch eine schwere Erkrankung wurde Irmgard Stellbrink erst mit acht Jahren eingeschult. In Detmold besuchte sie das Lyzeum, das sie trotz guter Leistungen 1915 abbrach. Eine Verlobung löste sie bereits nach kurzer Zeit. 1916 begann sie auf Wunsch ihrer Mutter eine Ausbildung am Lehrerinnenseminar, doch auch dies brach sie vorzeitig ab. Es folgten verschiedene Versuche, ihr Leben selbstständig zu gestalten und das Elternhaus zu verlassen. In Halberstadt erlernte sie in einer Familie die Haushaltführung, und im April 1917 arbeitete Irmgard Stellbrink als Erzieherin in Potsdam wiederum in einer Familie. Für kurze Zeit arbeitete sie in Berlin in weiteren Privatstellen und auch im Postscheckamt. Im November 1917, nun wiederum in Detmold, besuchte sie abermals auf Wunsch ihrer Mutter die Handelsschule. Auch dies brach sie vorzeitig ab. 1919 heiratete sie den Bergarbeiter Hugo Heiss, was den sozialen Vorstellungen ihrer Eltern widersprach, und zog mit ihm nach Langendreer, wo auch ihre beiden Söhne geboren wurden. Da Hugo Heiss zu einer Gefängnisstrafe verurteilt wurde, zog sie 1925 zurück zu ihren Eltern und brachte in Detmold ihre Tochter Meta zur Welt. Irmgard Heiss erkrankte nach der Geburt psychisch und wurde auf behördliche Anordnung im Mai 1925 in die Lippische Heil- und Pflegeanstalt Lindenhaus in Brake eingewiesen. Ihre Tochter wurde in einer Pflegeeinrichtung in Bethel untergebracht. Hier starb sie im Alter von acht Monaten im Oktober 1925.
Irmgard Heiss bat vergeblich nach ihrer Entlassung aus dem Lindenhaus um Aufnahme bei ihren Eltern, was diese jedoch als unzumutbar ablehnten. Ihre Versuche, ihren Lebensunterhalt selbst zu verdienen, scheiterten. Ihre Kinder wurden in Bielefeld in Pflegefamilien untergebracht. Anfang 1926 wurde sie wiederum auf behördliche Anordnung erneut im Lindenhaus eingeliefert, und wiederholt insistierten ihre Eltern auf ihre dauerhafte Unterbringung in einer Anstalt. Zudem leitete sie für ihre Tochter ein Scheidungsverfahren ein, dem Irmgard Heiss nicht widersprach. Im selben Jahr wurde sie in eine Anstalt nach Gütersloh verlegt, aus der sie allerdings floh. Unter dem falschem Namen Anni Bentheim schlug sie sich mit Fabrikarbeiten an unterschiedlichen Orten durch. 1928 wurde sie in Münster wegen Verhaltensauffälligkeiten und einer schlechten gesundheitlichen Verfassung von der Polizei in Gewahrsam genommen und in ein Krankenhaus gebracht, wo sie einen Suizidversuch unternahm. Daraufhin wurde sie in die psychiatrische Einrichtung Marienthal eingewiesen, danach in eine psychiatrische Anstalt nach Warstein. 1929 leiteten ihre Eltern ein Entmündigungsverfahren ein. Ihre ältere Schwester Helene wurde als ihr Vormund bestellt. Die Ehe mit Hugo Heiss wurde 1930 geschieden. Dessen Bemühungen, das Sorgerecht für seine Kinder zu bekommen, wurden von Irmgards Eltern angefochten. Stattdessen nahm ihr Bruder Karl Friedrich mit seiner Frau die Kinder als Pflegeeltern in der eigenen Familie auf.
Irmgard Heiss blieb zehn weitere Jahre als Patientin in Lengerich. 1938 meldete die dortige Einrichtung sie auf Anfrage des Kreisarztes in Münster als "fortpflanzungsfähig" und "fortpflanzungsgefährlich". Zu einer Zwangssterilisierung kam es dennoch nicht mehr. 1941 wurde Irmgard Heiss mit einem Sonderzug gemeinsam mit weiteren Langzeitpatienten in die Anstalt Weilmünster in Hessen verlegt. Drei Jahre später, im Jahr 1944, verschlechterte sich ihr Gesundheitszustand dramatisch. Ihre Schwestern Hilda und Helene holten die dem Hungertod nahe Irmgard Heiss auf eigene Verantwortung nach Detmold. Die Pflege überforderte sie jedoch, und so brachte Helene ihre Schwester Irmgard am 21. April 1944 wiederum ins Lindenhaus, wo bald darauf eine Lungentuberkulose diagnostiziert wurde, die vermutlich als Folge der Behandlung in der Anstalt Weilmünster zu bewerten ist. Irmgard Heiss starb im Lindenhaus an dieser Erkrankung und durch mangelnde beziehungsweise unterlassene medizinische Versorgung.
QUELLEN: StdA DT MK; LAV NRW OWL L 107 D Nr. 1893; Andreas Ruppert (Paderborn); Barbara Stellbrink-Kesy (Berlin)
LITERATUR: Stellbrink-Kesy (2020)
- Details
Rufname: Gerda
geb. 27.09.1922 in Detmold
| Religionszugehörigkeit: | jüdisch |
| Eltern: | Moritz Herzberg und Johanna Herzberg, geb. Frank |
| Bruder: | Fritz, später Fred Herzberg (10.06.1921 - 31.01.2008) |
| Großmutter: | Emilie Frank |
| Beruf: | Haushaltslehrling |
| Wohnorte: | [1919-1931] Detmold, Lange Str. 71 Detmold, Sachsenstr. 25 bei den Eltern 05.07.1935 nach W. Elberfeld, Bankstr. 24 abgemeldet 01.01.1938 Detmold, Sachsenstr. 25 bei den Eltern 10.08.1938 Berlin-Weißensee Jüdisches Taubstummenheim von Gr. Krotzenburg, [Kirchstr. 3] 04.12.1938 Detmold, Sachsenstr. 25 bei den Eltern 03.02.1941 nach Unna, Düppelstr.7 von Unna, Düppelstr. 7 Detmold: 06.12.1941 Sachsenstr. 25 I bei den Eltern 10.01.1942 Hornsche Str. 33 |
Durch eine schwere Erkrankung in ihren ersten Lebensjahren war Gerda Herzberg hör- und entwicklungsgeschädigt und stärker in die Obhut ihrer Eltern genommen als ihr älterer Bruder Fritz.
Ostern 1937 schloss sie die Volksschule ab und absolvierte eine Ausbildung als kaufmännische Angestellte und als Krankenschwester. Eine kontinuierliche Berufsausbildung war nicht mehr möglich und war zudem durch ihre gesundheitliche Beeinträchtigung erschwert. 1938 verbrachte sie vermutlich probeweise fünf Tage beim "Verein der Taubstummen ‚Jedide Jimim'" in Berlin. Ihr Bruder Fritz gelangte im Februar 1939 mit einem Kindertransport nach England. Von seinem Exil aus sollte er die zurückgebliebene Familie nachholen, was ihm nicht gelingen konnte. Der Plan, auch Gerda mit einem Kindertransport außer Landes zu bringen, ließ sich ebenfalls nicht in die Tat umsetzen, da sie die zum fraglichen Zeitpunkt gültige Altersgrenze überschritten hatte. Sie arbeitete 1941 in Unna im "Israelitische Altersheim für Westfalen". Dieses wurde am 28. Juli 1942 aufgelöst, seine 68 Bewohner und Bewohnerinnen wurden nach Theresienstadt deportiert.
Die Fluchtvorhaben der Familie Herzberg wurden mit dem generellen Auswanderungsverbot für Juden vom Oktober 1941 zunichte gemacht.
Zusammen mit ihren Eltern und ihrer Großmutter wurde Gerda Herzberg am 28. Juli 1942 mit dem Transport Nr. XI/1172 nach Theresienstadt verschleppt. Mit ihrer Mutter wurde sie am 9. Oktober 1944 mit dem Transport Ep-873 von dort nach Auschwitz deportiert. Gerda Herzberg wurde für tot erklärt.
Ihr Bruder Fritz, später Fred, überlebte, da es ihm gelungen war, 1939 mit einem Kindertransport nach England zu fliehen. Sein weiterer Fluchtweg führte ihn nach Nord-Rhodesien (heute Sambia), wo er später in die Britische Armee eintrat. Der Auftrag, seine Eltern, seine Schwester und seine Großmutter nachzuholen und damit ihr Leben zu retten, war nicht zu erfüllen. Fred Herzberg musste nach dem Ende des Krieges erkennen, dass seine nahen Angehörigen und weitere Familienmitglieder im Völkermord um ihr Leben gebracht worden waren. 1947 emigrierte er in die USA, wo er eine eigene Familie gründete. 2008 starb Fred Herzberg in St. Louis, ohne jemals wieder Deutschland betreten zu haben.
QUELLEN: StdA DT MK; LAV NRW OWL D1 Nr. 6141, L 113 Nr. 849; KAL K2 BEG Nr. 749, 750, 764, 795, 961, 1629; LATh-HStA Weimar; StdA Unna; Beit Theresienstadt; ZA B 1/34 Nr. 781, 857; Fred und Joanne Herzberg (USA); Arolsen Archives
WEITERE QUELLEN: Staatsanzeiger, 21.05.1919: HR (A 8), AG DT
Fa. J.A. Erda
Übergang auf Moritz Herzberg; Prokura Ehefrau Johanna
LZ, 13.06.1921: Geburtsanzeige eines Sohnes durch Moritz Herzberg und Frau Johanna
Korrespondenz Fred Herzberg, CJG Lippe
LITERATUR: Mitschke-Buchholz (2013)

Gerda Herzberg, [1938] (Sammlung Joanne Herzberg)
DOKUMENTE
Thbn.png)
Einwohnermeldekarte von Moritz, Johanna, Fritz und Gerda Herzberg (StdA DT MK)
Thbn.png)
Einwohnermeldekarte von Gerda Herzberg (StdA DT MK)
Thbn.png)
Mitteilung von Gerda Herzberg an die Polizeiliche Meldebehörde Detmold betr. der amtlich geforderten Namensänderung, 30.12.1938 (StdA DT D 106 Detmold A Nr. 3942)
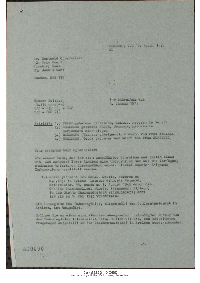
Auszug aus der Korrespondenz zu Gerda Herzberg
- Details
geb. 16.10.1885 in Marienborn/Siegen
| Religionszugehörigkeit: | jüdisch |
| Eltern: | Samuel Frank und Emilie Esther Frank, geb. Steinberg |
| Geschwister: | Paula Karseboom, geb. Frank Toni Jardeni-Sackheim, geb. Frank Hugo Frank |
| Ehemann: | Moritz Herzberg |
| Kinder: | Fritz, später Fred Herzberg (11.06.1921-31.01.2008) Gerda Herzberg |
| Beruf: | Einkäuferin, Geschäftsinhaberin |
| Wohnorte: | [1919-1931] Detmold, Lange Str. 71 Wuppertal-Elberfeld, Königstr. 13a Detmold: 01.08.1932 Moltkestr. 25 bei Otto 02.01.1934 mit Familie Bahnhofstr. 3 bei Sinalko [sic] 01.10.1936 Sachsenstr. 25 bei Buchholz 10.01.1941 mit Familie Hornsche Str. 33 "ohne Abmeldung verzogen" |
Johanna Frank absolvierte eine Lehre im Bereich der Damenkonfektion und war Einkäuferin und Abteilungsleiterin im Warenhaus-Konzern Alsberg. Am 11. September 1918 heiratete sie Moritz Herzberg in Elberfeld. 1919 übernahmen sie das renommierte Konfektionsgeschäft J.A. Erda in der Langen Straße 71 in Detmold. Johanna Herzberg erhielt Prokura. In ihrer Familie lebte auch ihre Mutter Emilie Frank. Die Familie zog 1931 aus nicht dokumentierten Gründen nach Elberfeld, um dort in die Kartonagefabrik ihres Bruders Hugo Frank einzutreten, kehrte aber im August 1932 nach Detmold zurück. Im selben Jahr, am 8. September 1932, meldete sie zusammen mit Elisabeth Böke das Gewerbe "Damenschneiderei" an und am 5. Mai 1933 den "Verkauf von fertiger Damenkonfektion". Ihre Wohnräume und auch das Etagengeschäft befanden sich in der Moltkestraße 25. Moritz Herzberg übernahm hier nun die Buchhaltung und führte die Gewerbebücher. Im Juli 1933 schied Elisabeth Böke aus. Bis Ende 1938 betrieb Johanna im verkleinerten Umfang das Geschäft weiter und musste sich auf den rapide schrumpfenden jüdischen Markt beschränken. Auch ihr wurde die Weiterführung ihres Betriebes zum Ende des Jahres 1938 verboten. Mit ihrer Familie lebte sie in der Sachsenstraße 25, das 1939 zum "Judenhaus" erklärt wurde. Dort und auch in der Hornschen Straße 33, einem weiteren sog. Judenhaus, nahmen sie auswärtige Mädchen, die in der jüdischen Schule unterrichtet wurden, als Pensionseltern auf.
Um ihre Auswanderung zu ermöglichen, schickten Johanna und Moritz Herzberg ihren Sohn Fritz mit einem Kindertransport nach England. Dort sollte er entsprechende Vorbereitungen treffen, um die Familie nachholen zu können. Alle ihre Fluchtvorhaben scheiterten.
Am 28. Juli 1942 wurde Johanna Herzberg zusammen mit ihrem Mann, ihrer Tochter Gerda und ihrer Mutter mit dem Transport Nr. XI/1-171 nach Theresienstadt verschleppt. Am 9. Oktober 1944 wurde sie von dort mit dem Transport Ep-872 nach Auschwitz deportiert und gehörte damit zu einem Transport, den nur sehr wenige Menschen überlebten.
Johanna Herzberg wurde für tot erklärt. Das amtliche Todesdatum wurde auf den 8. Mai 1945 festgesetzt.
Ihr Sohn Fritz, später Fred, überlebte als Einziger. Mit einem Kindertransport konnte er 1939 Deutschland verlassen und nach England fliehen. Kurze Zeit später führte ihn sein weiterer Fluchtweg nach Nord-Rhodesien (heute Sambia), wo er nach einiger Zeit Soldat der Britischen Armee wurde. Der Auftrag, seine Eltern, seine Schwester und seiner Großmutter nachzuholen und damit ihr Leben zu retten, war nicht zu erfüllen. Fred musste nach Kriegsende erkennen, dass seine engsten Angehörigen und weitere Mitglieder seiner Familie im Völkermord um ihr Leben gebracht worden waren. Er emigrierte 1947 in die USA, wo er eine eigene Familie gründete.
Bis zu seinem Tod im Jahre 2008 lebte er in St. Louis.
QUELLEN: StdA DT MK, D 106 S Nr. 16190; LAV NRW OWL D1 Nr. 6141, L 113 Nr. 849; KAL K2 BEG Nr. 749, 750, 764, 795, 961, 1629; LATh-HStA Weimar; Beit Theresienstadt; ZA B 1/34 Nr. 844; Fred und Joanne Herzberg (USA); Arolsen Archives
WEITERE QUELLEN: Staatsanzeiger, 21.05.1919: HR (A 8), AG DT
Fa. J.A. Erda
Übergang auf Moritz Herzberg; Prokura Ehefrau Johanna
LZ, 13.06.1921: Geburtsanzeige eines Sohnes durch Moritz Herzberg und Frau Johanna
Korrespondenz Fred Herzberg, GfCJZ Lippe
LITERATUR: Mitschke-Buchholz (2013)

Johanna Herzberg, [1938] (Sammlung Joanne Herzberg)
DOKUMENTE
Thbn.png)
Einwohnermeldekarte von Moritz, Johanna, Fritz und Gerda Herzberg (StdA DT MK)
Thbn.png)
Mitteilung von Johanna Herzberg an die Polizeiliche Meldebehörde Detmold betr. der amtlich geforderten Namensänderung, 30.12.1938 (StdA DT D 106 Detmold A Nr. 3942)

Auszug aus der Korrespondenz zu Johanna Herzberg
- Details
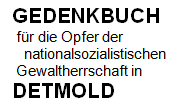


Thbn.png)
 und Lotte Heineberg (StdA DT MK)Thbn.png)
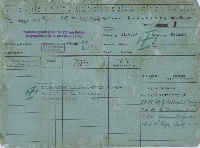

Thbn.png)