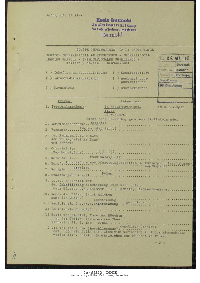B_Biographien
geb. 06.10.1936 in Detmold
| Religionszugehörigkeit: | jüdisch |
| Eltern: | Wilhelm (Fritz) Blumenthal (geb. 30.12.1901) und Ella Blumenthal, geb. Sostberg (geb. 05.10.1899) |
| Bruder: | Gerhard Blumenthal |
| Tante: | Anna (Aenne) Sostberg |
| Wohnorte: | Horn, Nordstr. 28 10.12.1941 Detmold |
Während ihr Vater nach Frankreich und Belgien fliehen konnte, wurde Ilse Blumenthal mit ihrem Bruder, ihrer Mutter und der unverheirateten Tante Anna Sostberg von Detmold aus am 13. Dezember 1941 nach Riga deportiert. Noch im Oktober 1941 hatte Ella Blumenthal einen Auswanderungsantrag für sich und ihre Kinder nach Brüssel gestellt, der mit "Rücksicht auf die kommende Endlösung der Judenfrage" abgelehnt wurde, so ein Zitat aus einem Ermittlungsverfahren gegen den damaligen SS-Obersturmbannführer Richard Hartmann.
Möglicherweise wurden sie zusammen von Riga nach Auschwitz deportiert.
Sie wurden 1950 vom Amtsgericht Horn für tot erklärt. Das amtliche Todesdatum wurde auf den 8. Mai 1945 festgesetzt.
Wilhelm (Fritz) Blumenthal konnte während seiner Deportation entkommen und emigrierte 1946 in die USA.
QUELLEN: StdA MK; LAV NRW OWL D 1 Nr. 6141, D 87 Nr. 10 Bd. I, D 103 Lippe Nr. 678-680; KAL K2 Detmold/Lemgo BEG Nr. 678, 679; ZA B 1/34 Nr. 882; Arolsen Archives
- Details
08.12.1872 in Königshütte/Schlesien - 07.09.1936 in Detmold
| Religionszugehörigkeit: | jüdisch |
| Ehefrau: | Alma Boehm, geb. Blank (12.10.1864 in Coppenbrügge - 07.06.1937 in Detmold) |
|
Tochter: |
Erna Quadfass, geb. Boehm (geb. 05.05.1899 in Detmold - 1996 in Edmonton, Kanada) |
| Beruf: | Kaufmann |
| Wohnorte: |
Detmold: |
David Boehm war verheiratet mit Alma Blank, der Tochter des Firmeninhabers Max Blank (Max Blank & Co. Manufaktur- und Modewaren, 1925 Max Blank & Co. Modehaus in der Bruchstr. 14a), dessen Geschäftsnachfolger er wurde. Mit ihr hatte er eine Tochter.
David Boehm geriet als einer der führenden Geschäftsleute alsbald in den Fokus der NS-Machthaber Detmolds. Eine harmlose Unterhaltung mit einer jungen Frau wurde ihm zum Verhängnis. Im Sommer 1935, und damit im Vorfeld der Nürnberger Rassegesetze, wurde er Opfer einer Diffamierungskampagne, in der er der sogenannten Rassenschande bezichtigt wurde. In zahlreichen Artikeln hetzte und verleumdete die Lippische Staatszeitung ihn und auch weitere jüdische Männer. Durch eine Denunziation des früheren Detmolder Ortsgruppenleiters Otto Keller wurde David Boehm am 10. August 1935 in "Schutzhaft" genommen.
Das Sondergericht Hannover verurteilte ihn zu neun Monaten Haft, die er im Konzentrationslager Esterwegen verbüßen musste. Dorthin wurde er am 3. September 1935 überführt. Zu diesem Zeitpunkt waren dort bereits mehrere jüdische "Rasseschänder" inhaftiert, obwohl es vor dem Inkrafttreten der Nünberger Gesetze strafrechtlich noch keine gesetzliche Grundlage gegen sie gab, nach der die Gerichte hätten urteilen können. Die Verbüßung einer Strafhaft in einem Konzentrationslager und nicht in einer Strafanstalt ist möglicherweise als besonders schwere Bestrafung bei jüdischen Angeklagten zu bewerten. In Esterwegen wurden die Häftlinge zu schwerster Arbeit zur Moorkultivierung gezwungen. Schikane, Arbeitsterror, Gewalt und Mord prägten den Alltag.
David Boehm überlebte die Lagerhaft schwer geschädigt und kehrte nach Detmold zurück, wo er an den Folgen seiner Inhaftierung starb. Er gehörte damit zu den ersten Detmolder Todesopfern des Terrorregimes. David Boehm wurde auf dem jüdischen Friedhof in Detmold beigesetzt. Etwa ein Jahr später verstarb auch seine Frau, deren Grab sich ebenfalls auf dem Detmolder Friedhof befindet.
Ihre Tochter Erna Quadfass überlebte Theresienstadt und wanderte 1951 nach Kanada aus, wo sie hoch betagt 1996 starb. Deren Sohn Helge (später Hardy) wurde als sogenannter Halbjude verfolgt und überlebte Zwangsarbeitslager und "Arbeitserziehungslager". 1951 emigrierte er zusammen mit seiner Mutter nach Kanada, wo auch er in hohem Alter verstarb.
QUELLEN: StdA DT MK; LAV NRW OWL D 22 DT 31/86, L 80 IIb Gr. II Tit. 1 Nr. 23, L 113 Nr. 463; KAL K2 Detmold/Lemgo BEG Nr. 831; Arolsen Archives; Gedenkstätte Esterwegen
WEITERE QUELLEN: D 106 DT Nr. 747, Amtsbatt, 05.04.1905, Amtsblatt, 14.10.1905, Staatsanzeiger, 08.10.1919, Die Fackel, Juli 1920 "Schiebermache", LZ, 29.06.1923: Verlobungsanzeige Erna Boehm, Detmold, und Dr. Heinz Quadfaß, München, Staatsanzeiger, 12.09.1928 und 08.12.1928,
LZ, 13.08.1935: "In Haft genommen"
LStZ, 11.08.1935: "Jude Boehm verhaftet", ebd. Lippischer Beobachter. Verhaftung des David Boehm solle als Warnung dienen.
LTZ, 11.08.1935: "Jude Boehm in Haft genommen"
LStZ, 10.08.1935: "Jude Boehm auf Mädchenjagd"
LITERATUR: van Faassen/Hartmann (1991), Hartmann, Deportation (1998)
- Details
Rufname: Emil
26.03.1902 in Herford - 31.07.1943 in der Heil- und Pflegeanstalt Eglfing-Haar
| Religionszugehörigkeit: | evangelisch |
| Eltern: | Emma Bojahr, geb. Thielker (geb. 01.01.1869 in Bochum) und Emil Bojahr (geb. 19.11.1859 in Gelsenkirchen-Schenfelsdorf - 24.10.1906, Prediger, Pastor einer Baptistengemeinde) |
| Geschwister: | Hedwig Bojahr (geb. 12.03.1890 in Bochum-Eppendorf, Köchin), Wilhelm Bojahr (geb. 22.12.1891, Ziegler), Walter Bojahr (geb. 31.03.1892 in Bochum-Eppendorf, Ziegler, Verwalter), Paul Bojahr (geb. 16.09.1893 in Bochum-Eppendorf), Emma Bojahr (geb. 27.09.1896 in Bochum), Martha Bojahr (geb. 23.05.1900 in Bochum), Else Bojahr (geb. 30.04.1905 in Herford - 29.10.1947), Elfriede Bojahr (geb. 10.11.1918) |
| Beruf: | Elektromonteur |
| Wohnorte: | Herford, Göbenstr. 248 [...] 04.1904 Herford, D[...] 19 04.04.1905 Herford, Am Hang 3 Heidenoldendorf Nr. 187 23.10.1925 Vlotho 10.02.1926 Heidenoldendorf Nr. 187 07.08.1933 nach Amerika abgemeldet [sic !] |
Emil Bojahr war der Sohn eines Baptistenpredigers und wuchs in einer kinderreichen Familie mit acht Geschwistern auf. Seine ersten Lebensjahre verbrachte er in Herford, bevor die Familie nach Heidenoldendorf (heute Detmold) zog. Er absolvierte eine Ausbildung zum Elektromonteur und arbeitete auch einige Zeit in seinem Beruf. Emil Bojahr litt an einer psychischen Erkrankung. Die fraglichen Quellen geben keine Auskunft darüber, wann die Krankheit erstmals diagnostiziert wurde, und auch das Datum seiner Einweisung in die Heil- und Pflegeanstalt Lindenhaus ist nicht dokumentiert. Belegt ist hingegen seine Verlegung am 16. März 1933 aus dem Lindenhaus in die Provinzialheilanstalt Gütersloh. Bezeichnenderweise wurde in den Meldeunterlagen der Stadt Detmold noch mit Datum des 7. August 1933 seine Abmeldung nach Amerika eingetragen. Zu diesem Zeitpunkt war Emil Bojahr allerdings bereits seit einigen Monaten stationär in Gütersloh untergebracht.1
Neun Jahre später wurde er am 7. Februar 1942 von dort in die Provinzialheilanstalt Dortmund-Aplerbeck verlegt und am 24. Juni 1943 in die Heil- und Pflegeanstalt Eglfing-Haar des Bezirksverbandes Oberbayern gebracht. Laut des dortigen Jahresberichtes für das Jahr 1943 wurden "von den in besonders luftgefährdeten Gebieten liegenden Anstalten Dortmund-Aplerbeck und Hausen im Juni und Juli 220 bzw. 210 größtenteils sehr pflegebedürftige männliche Kranke übernommen", zu denen auch Emil Bojahr gehörte.
Für viele der Patienten endete in Eglfing-Haar ihr Leidensweg. Denn seit dem 30. November 1942 waren mit dem sog. Hungerkosterlass des Bayerischen Staatministerium des Innern in den Bayerischen Heil- und Pflegeanstalten für "nicht produktiv arbeitende" und pflegebedürftige Patienten eine sog. Sonderkost eingeführt worden. Durch den gezielten Nahrungsentzug sollte der Tod der Kranken bewusst herbeigeführt werden. In der Heil- und Pflegeanstalt in Eglfing-Haar wurden in Folge des "Hungerkosterlasses" zwei Krankenpavillons zu "Hungerhäusern" umfunktioniert, Haus 22 für Frauen und Haus 25 für Männer, in denen den Kranken eine fett- und proteinarme Kost verabreicht wurde. Die Mangelernährung führte zu einer körperlichen Schwächung, durch die die ohnehin desolaten und vernachlässigten Patienten schneller an einer Lungentuberkulose erkrankten und daran starben. Diese Diagnose ermöglichte den Ärzten, in den Leichenschauscheinen eine vorgeblich natürliche Todesursache einzutragen. In Eglfing-Haar wurde die Durchführung der "Sonderkost" durch den Direktor Hermann Pfannmüller persönlich überwacht und kontrolliert. Gelegentlich ordnete dieser auch an, den Tod durch die Verabreichung starker Schlafmittel zu beschleunigen.
Emil Bojahr starb am 31. Juli 1943 im Alter von 41 Jahren nach nur einer Woche im "Hungerhaus 25". Als offizielle Todesursache wurde Tuberkulose angegeben. Emil Bojahr gehört durch die willentliche, absichtsvolle Herbeiführung seines Todes durch Unterlassung, Vernachlässigung und gezielten Nahrungsentzug zu den Opfern der dezentralen "Euthanasie".
1 Laut www.ancestry.com finden sich auf einer Passagierlisten (1820-1957) nach New York mehrere Personen mit Namen Bojahr, so auch ein Emil Bojahr. Die Identität ist jedoch ungeklärt.
QUELLEN: StdA DT MK; LWL-Archivamt für Westfalen Best. 661 Nr. 180; KAH; Archiv des Bezirks Oberbayern, München
LITERATUR: Stockdreher (1999), Tiedemann, Hohendorf, von Cranach (2018), Walter (1996)
- Details
geb. 15.05.1883 oder 1881, auch: 08.06.1881 in Roszniatow (Galizien, heute: Roschnjatiw/Westukraine)
| Religionszugehörigkeit: | jüdisch |
| Beruf: | Pfandleiherin, Geschäftsinhaberin |
| Eltern: | Bernhard Glattstein und Paula Glattstein, geb. Fruchter |
| Ehemann(gesch.): | Max Meier Bonom |
| Töchter: |
Paula Bonom (geb. 22.10.1912 in Hannover) |
| Wohnorte: | 22.02.1914 von Hannover Detmold: 07.04.1914 Elisabethstr. 59 04.04.1919 Hornsche Str. 35 14.01.1924 Meiersfelderstr. 2 1925 Blomberger Str. 25 (Adressbuch) 07.05.1927 Lange Str. 67 07.02.1929 Elisabethstr. 20 04.11.1930 Weinbergstr. 15 01.05.1933 Paulinenstr. 61 01.10.1934 Gartenstr. 6 bei Leffmann "ohne Abmeldung verzogen" Zbaszyn, Senatorska Hotel [Fellerosa] |
Regina Bonom-Horowitz gehörte zu den sogenannten Ostjüdinnen und -juden, stammte wie ihr späterer Ehemann aus Galizien und lebte seit 1904 in Deutschland. Ihre Staatsangehörigkeit wurde auf der Einwohnermeldekarte der Stadt Detmold zunächst mit Österreich angegeben und später in "unbekannt" geändert. Um 1908 hatte sie in Hannover Max Bonom geheiratet. Nach der Scheidung dieser Ehe im Jahre 1921 wurden die Töchter Klara und Paula im jüdischen Waisenheim mit integrierter Schule untergebracht. Ihre Schwester Marie folgte dorthin im Jahr 1927. Alle drei Töchter kehrten nach der Schulentlassung zurück nach Detmold. Ihre Mutter eröffnete derweil in Detmold ein Alteisengeschäft, das sie vier Jahre später, im Jahr 1925, aufgab. Die Meldeunterlagen der Stadt geben ihre Staatsangehörigkeit mit "unbekannt" an, ihr Beruf wird mit "Geschäftsinhaber" bezeichnet. Von 1925 bis 1928 war sie als Vertreterin der Wäschefabrik Buchsbaum, Bielefeld tätig. 1930 eröffnete sie eine konzessionierte Pfandleihanstalt in der Weinbergstraße 15 (heute Paulinenstraße, dort, wo heute ein Denkmal an die Berliner Mauer erinnert). Im Dezember 1932 wurden die Fensterscheiben ihres Geschäfts zwei Mal zertrümmert und Pfandgegenstände von einem Bielefelder SS-Mann und Theologiestudenten gestohlen, der angab, "das Judentum damit schädigen zu wollen". Nach dem daraufhin angestrengten Prozess wurde die Pfandleihe boykottiert, so dass Regina Bonom-Horowitz über keinerlei Einnahmen mehr verfügte und auf Unterstützung durch die Fürsorge angewiesen war. Am 28. Oktober 1938 wurde sie in der sogenannten Polenaktion auf Befehl des Reichsführers SS zusammen mit dem ebenfalls ostjüdischen Josef Leib Vogelhut von der Polizei verhaftet und in das Flüchtlings- und Zwangsarbeitslager für Juden Zbaszyn/Bentschen an die polnische Grenze verschleppt. Ihre Bemühungen vom 9. November 1938, nicht nur Beschwerde gegen ihre Ausweisung einzulegen, sondern auch eine Wiedereinreise in das Reichsgebiet "zwecks Regelung der wirtschaftlichen Angelegenheiten" zu erreichen, wurden am 15. November 1938 vom lippischen Polizeiführer mit der Begründung abgelehnt: "Die von dem Beschwerdeführer gegebene Begründung ist durch die Ereignisse der letzten Tage hinfällig geworden." (S. LAV NRW OWL L 80 Ie Gr. IV Tit. 3 Nr. 32 Bd. 5).
Ein letztes Lebenszeichen von Regina Bonom-Horowitz ist ein Brief über das Rote Kreuz vom 29. Oktober 1941 aus dem Arbeitslager und Ghetto Rzeszow.
Sie gilt als verschollen. In Dokumenten des Kreises Lippe findet sich der Hinweis "mit Wirkung vom 8. Mai 1945 als verstorben vermutet".
Ihre Töchter konnten in den 1930er Jahren nach Palästina emigrieren. Für die Tochter Marie ist der 1. Mai 1938 als Datum des Wegzuges belegt.
QUELLEN: StdA DT MK; LAV NRW OWL D 87 Nr. 16,17, D 103 Lippe Nr. 723, 726, 748, D 106 Detmold A Nr. 4165, L 80 I e Gr. IV Tit. 3 Nr. 32 Bd. 5 ; ZA B 1/34 Nr. 767, 856; KAL K2 Detmold/Lemgo BEG Nr. 726, 748; Arolsen Archives
WEITERE QUELLEN: LAV NRW OWL D 106 DT Nr. 752; LZ, 22. und 23.12.1932, 05.01.1933, 16.03.1933
LITERATUR: van Faassen/Hartmann (1991), Müller (1992), Müller (2008)
- Details
geb. 25.02.1883 in Dolina (Galizien)
| Religionszugehörigkeit: | jüdisch |
|
Ehefrau (geschieden): Töchter:
|
|
| Wohnorte: | Hannover Detmold: (differierende Angaben in der älteren und jüngeren Meldekartei) 22.02.1914 Elisabethstr. 59 (auch: Lagesche Str.60) [Notiz:] War nicht abgemedet vom Militär (22.11.1918 Hornsche Str. 35) 27.02.1919 Hannover 01.03.1919 Detmold, Hornsche Str. 35 13.03.1919 Hannover 04.04.1919 Hornsche Str. 35 19.08.1919 Uslar 01.05.1920 Westerholt, Geschwisterstr. 44 07.06.1920 Detmold, Hornsche Str. 35 17.08.1920 Bochum 31.02.1922 von Stade kommend Detmold, Hornsche Str. 35 19.03.1922 Berlin, Neuer Graben 39 Reg. Bez. Düsseldorf, [Essen] 27.10.1941 Deportation in das Ghetto Lodz, Blattbinder 3/1 |
Max Bonom gehörte zu den sogenannten Ostjuden und stammte aus Galizien, das er aus Angst vor Judenfeindschaft, Pogromen und wegen der dortigen Not verlassen hatte. Er war mit der ebenfalls aus Galizien stammenden Regina Bonom-Horowitz verheiratet und war laut Melderegister an vielen Orten ansässig. Nur wenige Informationen geben detaillierten Aufschluss über seinen Lebensweg. So war Max Bonom 1920 in Westerholt an einer Adresse gemeldet, wo ein auch aus Galizien stammender Jude ein Textilgeschäft betrieb. 1921 wurde die Ehe mit Regina Bonom-Horowitz geschieden. Die gemeinsamen Töchter wurden darufhin in dem jüdischen Waisenhaus in Paderborn untergebracht, wo sie auch die integrierte Schule besuchten.
Max Bonoms letzter Wohnort ist mit "Regierungsbezirk Düsseldorf" nur eingegrenzt dokumentiert. Von Düsseldorf wurde er vermutlich am 27. oder 28. Oktober 1941 - weitere Quellen nennen auch den 23. Oktober 1941 - mit einem Transport aus dem "Gestapo-Bezirk Düsseldorf" in das Ghetto Litzmannstadt/Lodz deportiert.
Er gilt offziell als verschollen. Weitere Quellen nennen den 26. Oktober 1942 als Todesdatum. Als Todesort wird das Ghetto Lodz angegeben.
QUELLEN: StdA MK DT; LAV NRW OWL D 87 Nr. 16,17, D 106 Detmold A Nr. 4165, L 80 I e Gr. IV Tit. 3 Nr. 32 Bd. 5 ; KAL K2 Detmold/Lemgo BEG Nr. 726, 748; Mahn- und Gedenkstätte Düsseldorf; ZA B 1/34 Nr. 767; Arolsen Archives
WEITERE QUELLEN: LAV NRW OWL D 103 Lippe Nr. 723, 726, 748, D 106 DT Nr. 752; LZ, 22. und 23.12.1932, 05.01.1933, 16.03.1933
LITERATUR: van Faassen/Hartmann (1991), Müller (1992), Müller (2008)
- Details
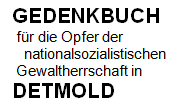


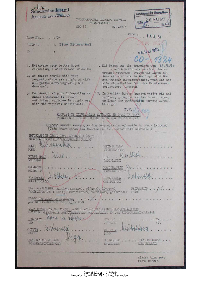

Thbn.png)
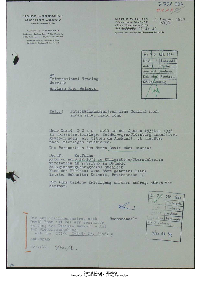
Thbn.png)
Thbn.png)

Thbn.jpg)
Thbn.png)